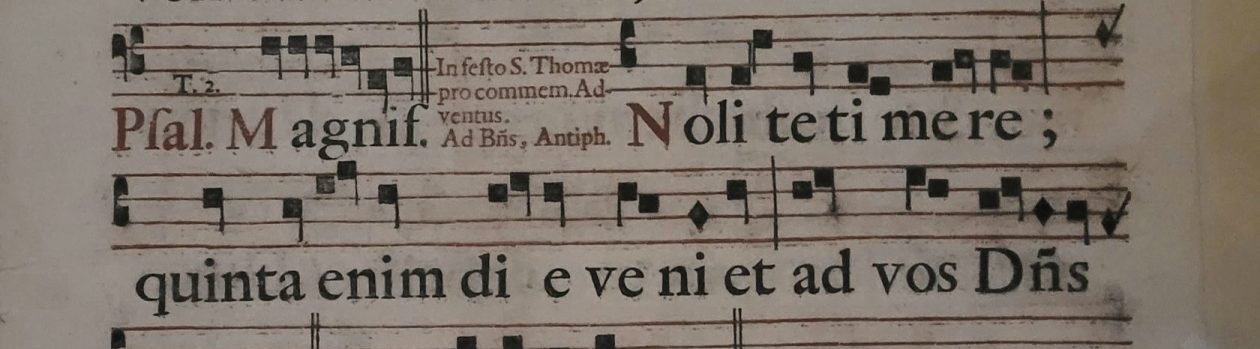Seinen „Dichter der Angst“ hat Manfred Koch mitgebracht nach Basel, gesamt 560 (dem Lektor und Verlag zum Teil abgetrotzte) Seiten umfasst die Rilke-Biographie, die in 12 Kapiteln ein Panorama auf den „Trostdichter der Deutschen“ öffnet mit Gewichtung einzelner Kapitel auf das „Leben im Werk“, anderer auf das „Werk im Leben“. Die Kapitel tragen beredte Namen wie Großstadttod, Mutterfieber, Gottbauen, Kindheitsschrecken, Engelssturm, Herzgebirge, Schweizklang.
Wie im Buch (dessen Lektüre mir noch bevorsteht) erzählt Manfred Koch (geb.1955 in Stuttgart, bis 2021 Dozent deutscher Literaturgeschichte an den Universitäten Gießen, Tübingen und Basel) auch im Literaturhaus Basel locker, detail- und kenntnisreich über „seinen“ Rilke, zu dem er in jungen Jahren allerdings erst bekehrt werden musste. Gelungen ist diese Bekehrung Kochs damaliger Freundin und seit langem Ehefrau, der Schriftstellerin Angelika Overath, mit der Empfehlung, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge zu lesen, wie Koch selbst im Vorwort schreibt. So nimmt es nicht wunder, dass dieser Rilke-Roman, der ein „Angst-Buch“ sei, einen zentralen Platz in Kochs Rilke-Biographie einnimmt, die zum Jahr des 150.Geburtstages des Dichters (4.Dezember 1875) erschienen ist, nach drei Jahren Arbeit daran.
In der Kürze des Abends können vielfältige interessante Einzelheiten nur schlaglichtartig beleuchtet werden, zum Beispiel der Gedanke, dass zwei große Angstdichter (die sich nur einmal persönlich begegneten bei einer Lesung in München) aus Prag stammen (Kafka und Rilke), die Tatsache, dass Rilke 1905 Insel-Autor wurde und der Verleger Anton Kippenberg über lange Jahre treu seinem Autor verbunden war (und ihm auch unter schwierigen Umständen Geld in die Schweiz transferierte), die faszinierende Klanglichkeit von Rilkes Sprache (Koch zitiert dazu aus einem 1924 entstandenen Briefgedicht Rilkes an eine junge Wienerin: „das Tödliche hat immer mitgedichtet, nur darum war der Sang so unerhört“), die speziellen Bedürfnisse Rilkes an den geeigneten Schreib- „Raum“, den „Zweikampf“ Rilkes mit der Stadt Paris, der Wunsch, Kunst aus dem absichtslosen Arbeiten der Hände entstehen zu lassen (siehe auch Rodin-Essay), das im Jardin des Plantes eingeübte intensive Schauen ohne Absichten.
Rilkes Lesung in Basel im Jahr 1919 vor hunderten Menschen kommt auch zur Sprache, sie fand im Musiksaal des Stadt-Casinos statt, wie eine Quelle mir aufschließt, Rilke hatte sich für diese Lesungen vor großer Zuhörerschaft eine durchdachte Strategie angeeignet und so sei es ihm auch hier gelungen, „den Saal mit seiner warmen Baritonstimme zu durchdringen“. Welche Orte in und um Basel für Rilke in den Jahren 1919 und 1920 noch bedeutsam sind (u.a. das Hotel Trois Rois), wird im September 2025 ein Leseabend und Spaziergang aufgreifen, konzipiert und durchgeführt von Martina Kuoni, die auch den gestrigen Abend im Literaturhaus moderierte.
(Buchempfehlung: Manfred Koch: Rilke. Dichter der Angst. Eine Biographie, Verlag C.H.Beck, München 2025)
(Artikel: Rilke und Basel, Der Dichter auf dem Schönenberg – Freunde – Auswirkungen. E-Periodica ETH Bibliothek Zürich 2022. Baselbieter Heimatblätter Band 70, 2005)
(„hoffentlich bald wieder in Sent!“ hat Manfred Koch mir beim Signieren ins Buch geschrieben – die Hoffnung, einmal wieder bei einem Kurs der Schreibschule von Angelika Overath und Manfred Koch dabeizusein, teile ich)