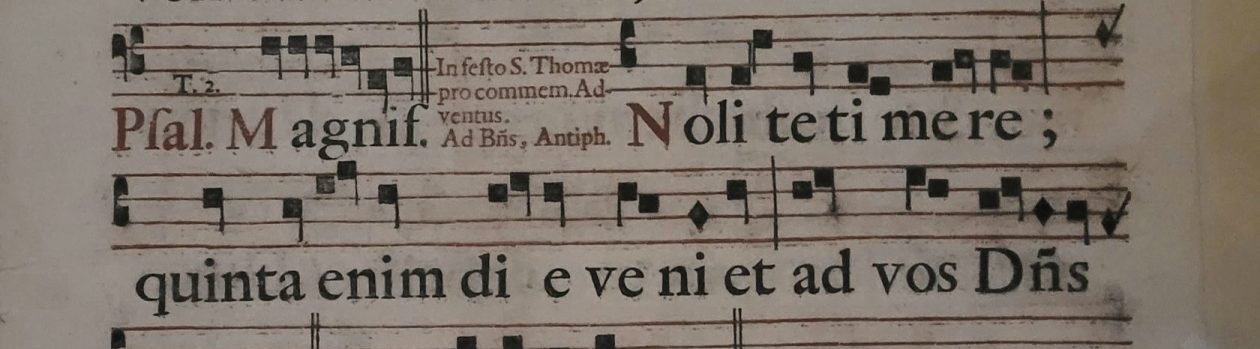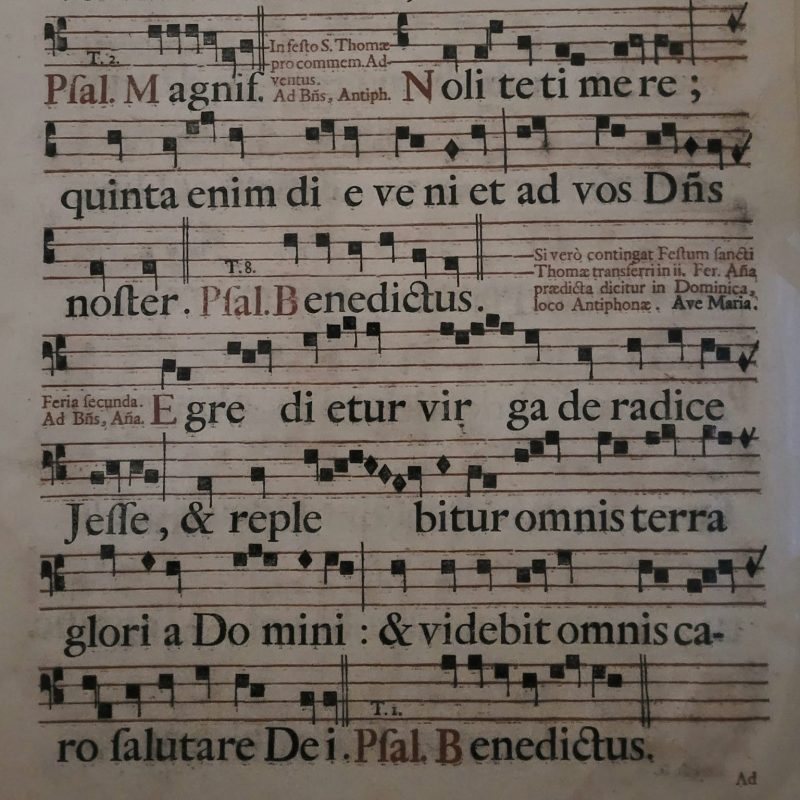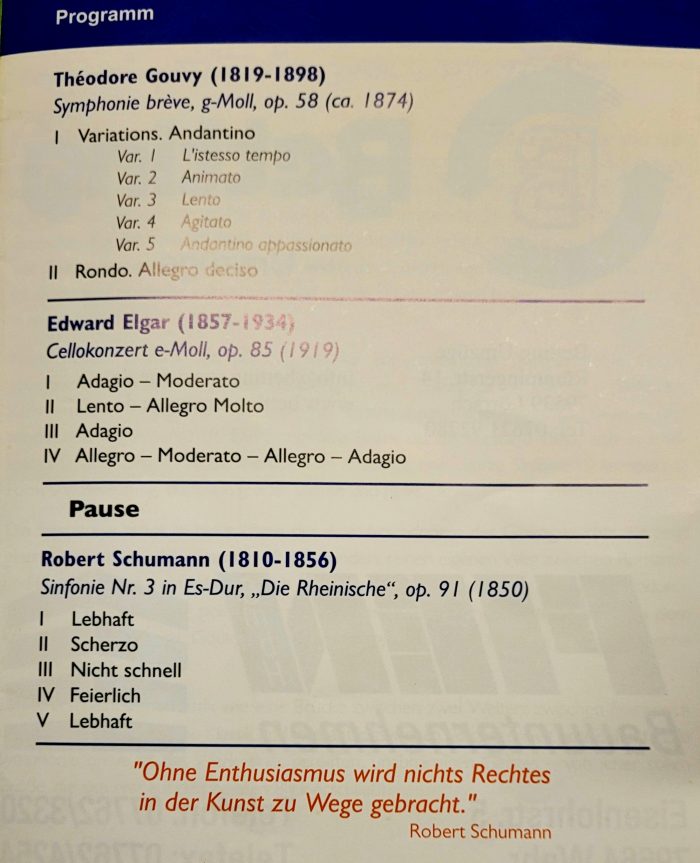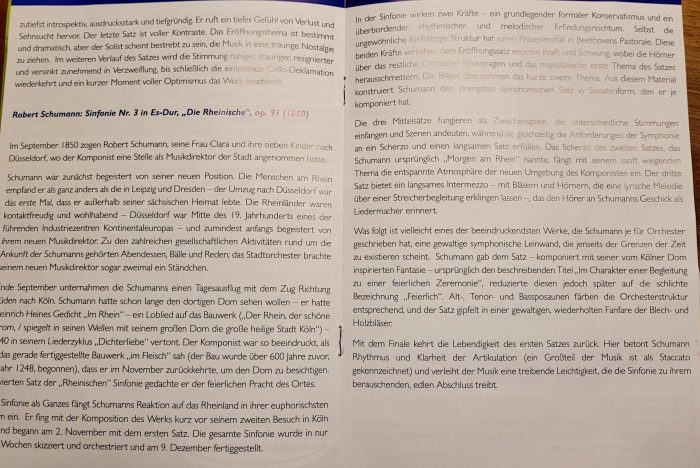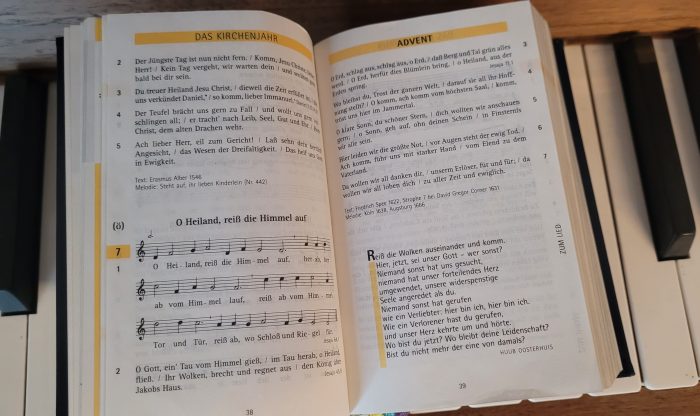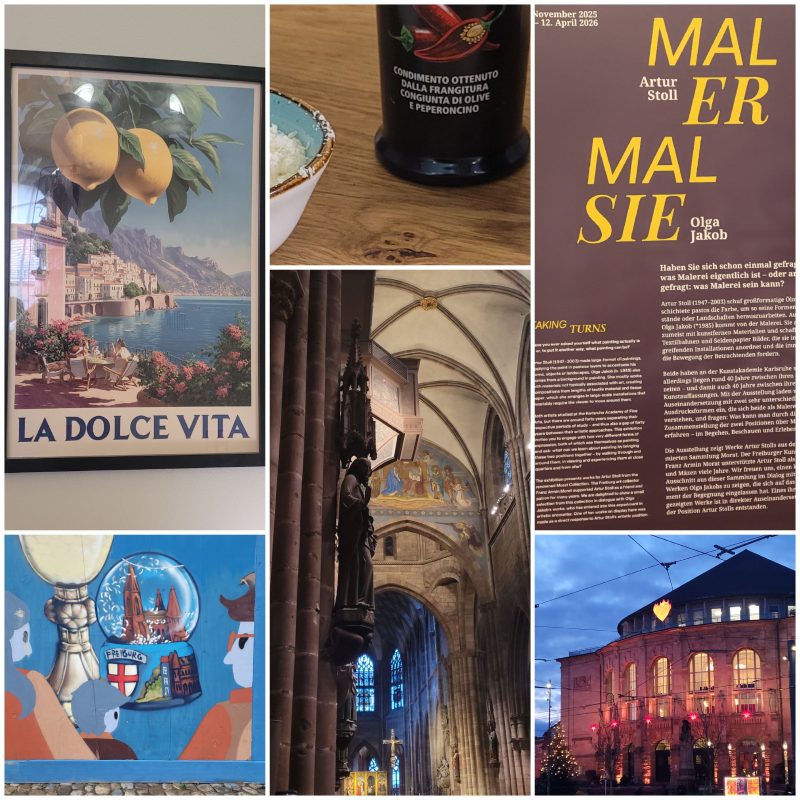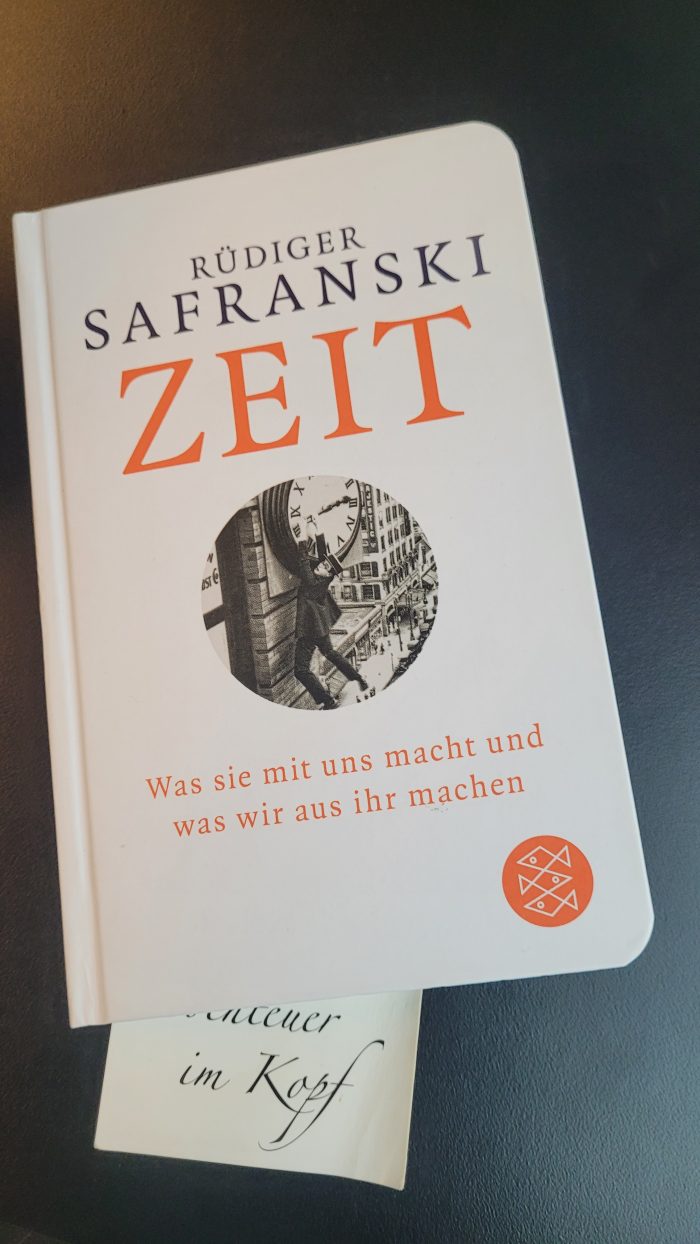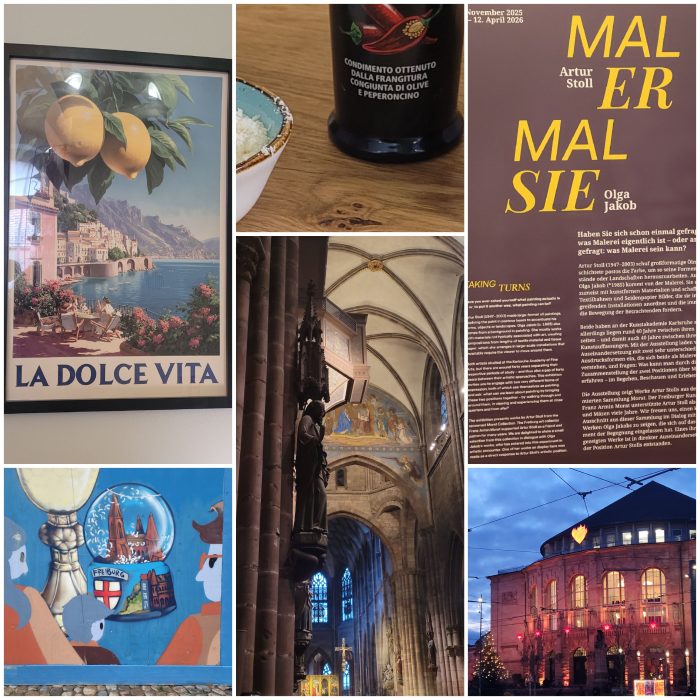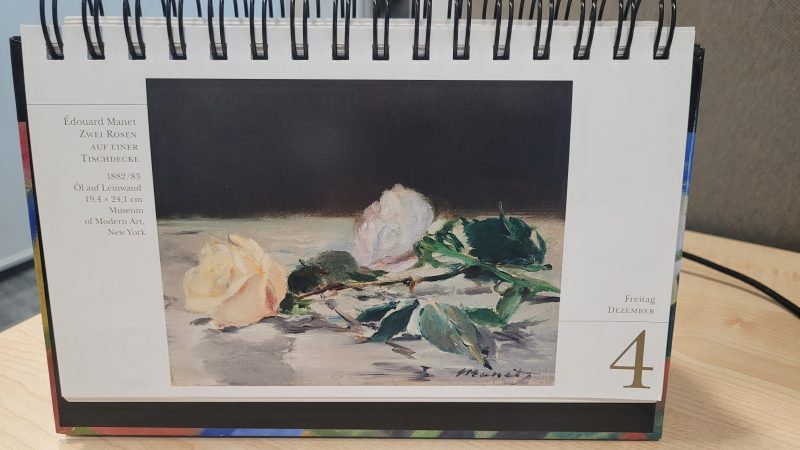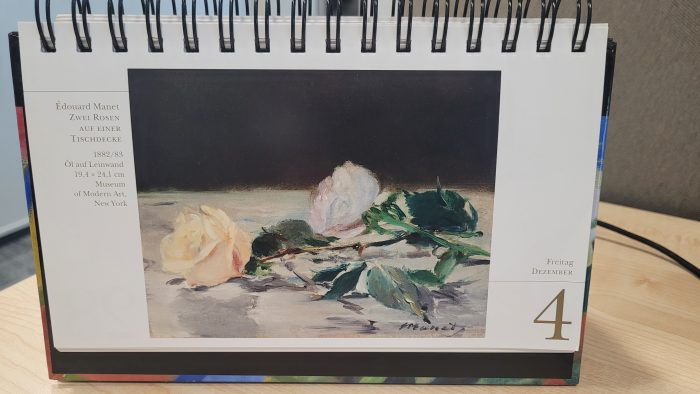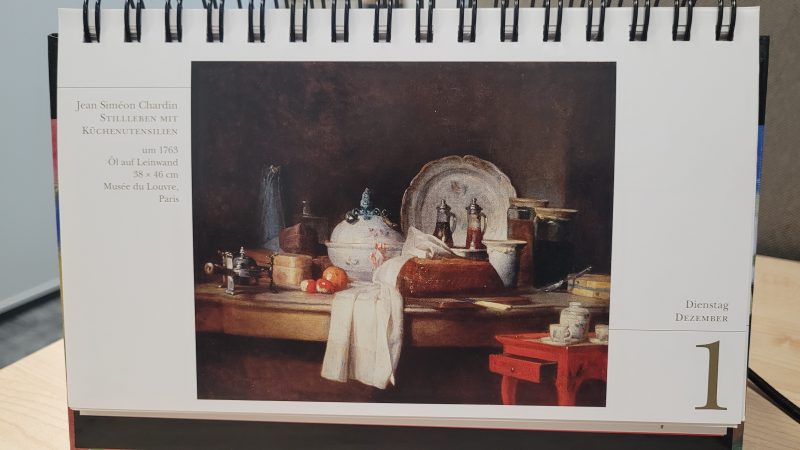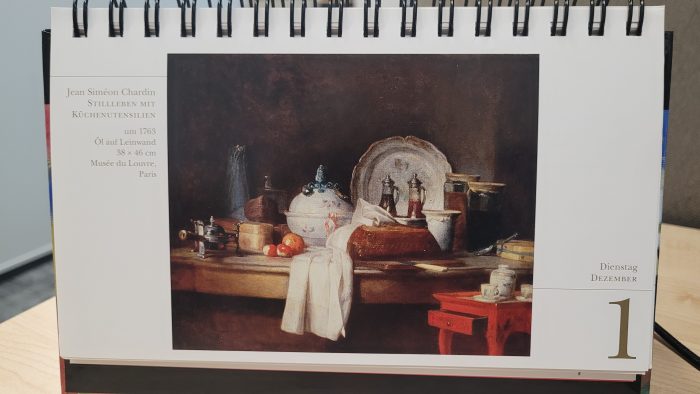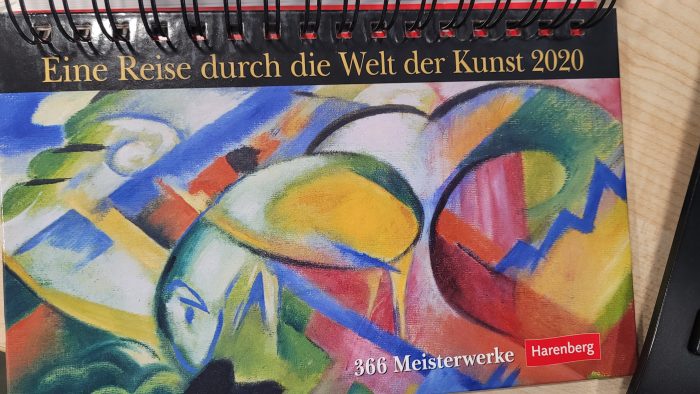lässt zu, dass ich auf die Retraite zurückblicke:

Der Festtagscharakter bleibt dem Donnerstag in Ralligen erhalten, am Abend werde ich mich einigen Brüdern und Hausgästen anschließen und nach dem Essen ein weiteres im Tongeschirr gereichtes Mahl zelebrieren, nachdem wir durchs Dunkel den Feldweg hinauf gepilgert sind zur Wegkapelle, dabei an Lichtstationen innegehalten und uns mit Worten in Lesung und Gesang gestärkt haben. Laudate omnes gentes, laudate dominum – die wiederholten Schleifen des Liedes laufen uns aus der Kapelle voraus und legen sich in klarer Nacht aufs Schwarz der Landschaft. Erreichen sie auch die Himmel, in denen die Sterne ein entschiedener Widerschein unserer kleinen Lichter sind ? Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg… werden wir später noch intonieren, denn das Singen will an diesem Abend kein Ende nehmen, beim Feuer im Kaminzimmer finden sich Etliche zusammen und folgen der Pianistin besinnlich bis spritzig. Zuletzt kredenzt jemand sogar noch Eis, flankiert von Sahne, aus den Tiefen der Küche. Die Wegkapelle war mir bereits am Ende des Morgenrundganges ein Ziel, eine geteilte Holztür ließ sich mit Riegeln öffnen, auf dem aus unregelmäßigen Steinen gepflasterten Boden der ehemaligen Scheune fand ich rote Sitzkissen auf Strohballen, vor dem Kreuz an der Stirnwand eine Krippe, in der aus weißen Laken das Kind seine Ärmchen hochreckt. Ist das Kind aus Ton oder dunklem Holz gefertigt? Ich versage meiner Hand die Berührung. Nischen der Bruchsteinwände nehmen Kerzen und Bücher auf, verschiedene Bibelausgaben sind es vor allem. Auf einfachem Ambo liegt das fünfte Kapitel des Matthäusevangeliums aufgeschlagen, die Verse eins bis zehn der Seligpreisungen sind fett gedruckt, genau wie die Verse dreizehn und vierzehn, die von Salz und Licht handeln: Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Über der geöffneten Bibel hat man einen von Beat Rinks Sätzen auf den Ambo gelegt: Eine Kirche, die nie nach Stall riechen wird, verleugnet ihre Herkunft. Die Wegkapelle tut das nicht, der gestaltende Künstler hat ihren Scheunencharakter bewahrt, durch die Öffnungen der hölzernen Wand- und Dachsparren-Konstruktion fällt das Himmelslicht herein und der Blick hinaus auf Bergwiesen, auf See und Niesen. Giemwand heißt wohl der Fachausdruck für den Aufbau der Scheune, am Nachmittag lese ich das in Gunten auf blechernem Schild, das auf eine alte Scheune als letzten Zeugen von kleinbäuerlichen und kleingewerblichen Tätigkeiten im Dorfkern hinweist. Neben der Wegkapelle sind bäuerliche Tätigkeiten noch alltäglich, mittags wurde beim nahen Misthaufen mit dem Schaufeltraktor geschafft, der Stallgeruch verteilt. Nach Gunten laufe ich nicht auf der Höhe, sondern am See entlang, ich raste auf Bänken, die sich Wasser und Sonne zuwenden, ab irgendwann taucht im Blick Richtung Interlaken das schneeweiße Antlitz der Jungfrau auf, im verwaisten Guntener Strandbad weist ein Schild darauf hin, dass Tauchen hier eine Wintersportart und im Sommer verboten sei, und tatsächlich begegnen mir beim Zurückgehen an den Rastplätzen Menschen, die sich aus tauchtauglichen Anzügen schälen und ihr Equipment in den Kofferräumen ihrer Kombis verstauen. Auch auf diesem Gang wandert der Niesen immer mit und später, als er in der Nacht kaum auszumachen ist, werde ich denken, dass er selbst der Dunkelheit des Himmels ein treuer Begleiter ist.
Beat Rink https://share.google/wWmO5t5DjP4fxakw4

(Fortsetzung/Schluss folgt)