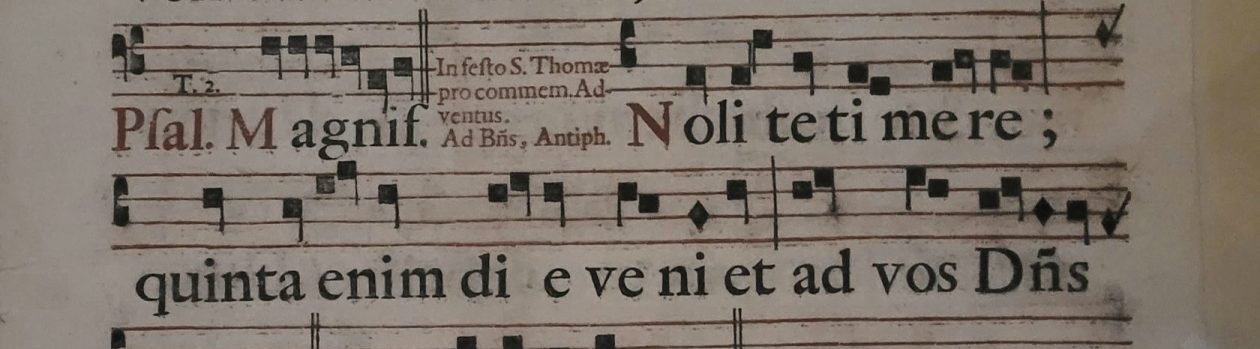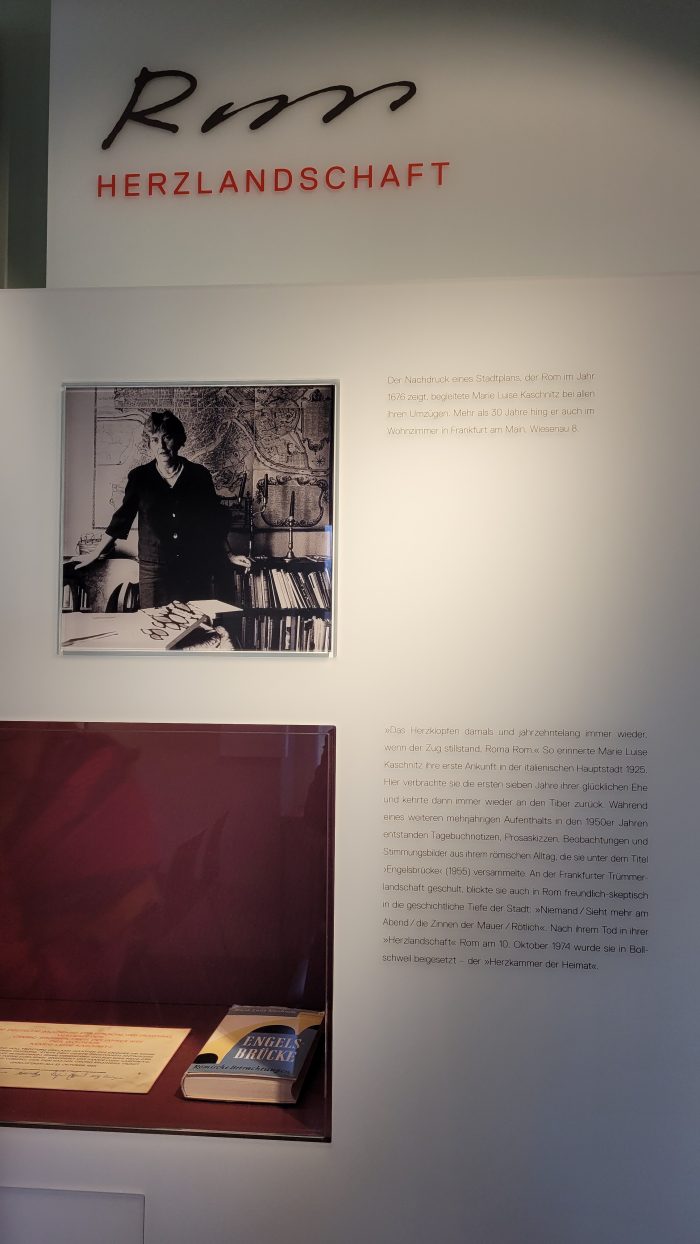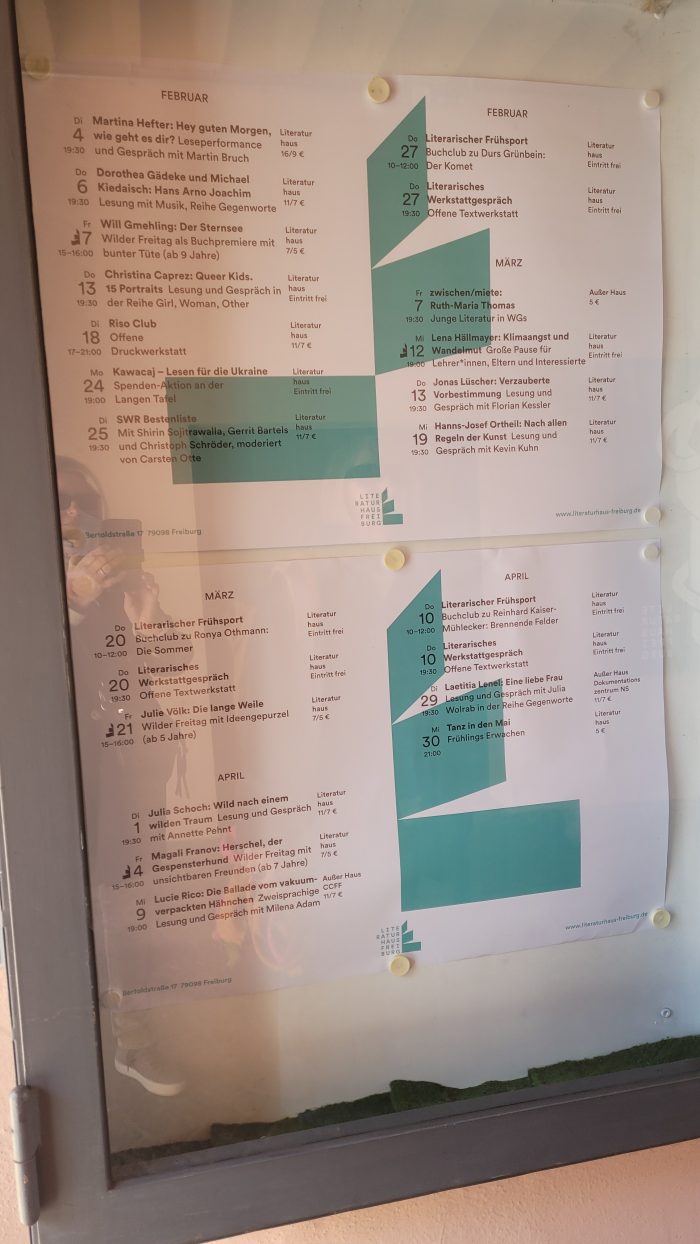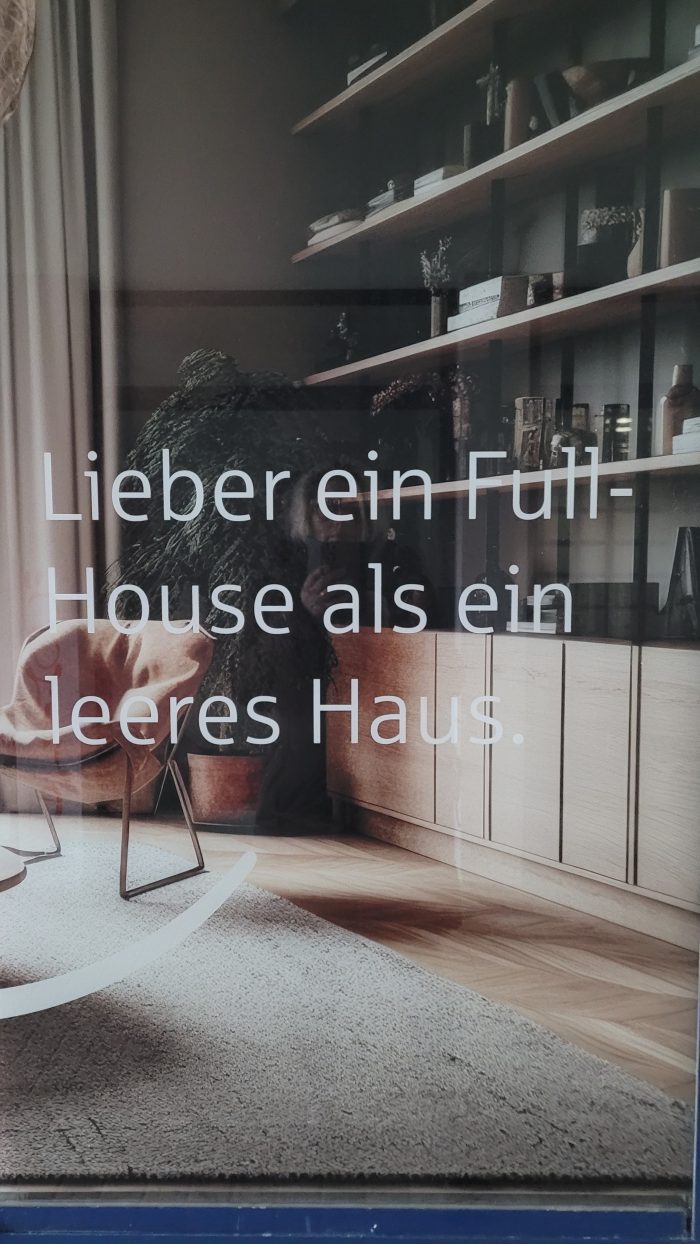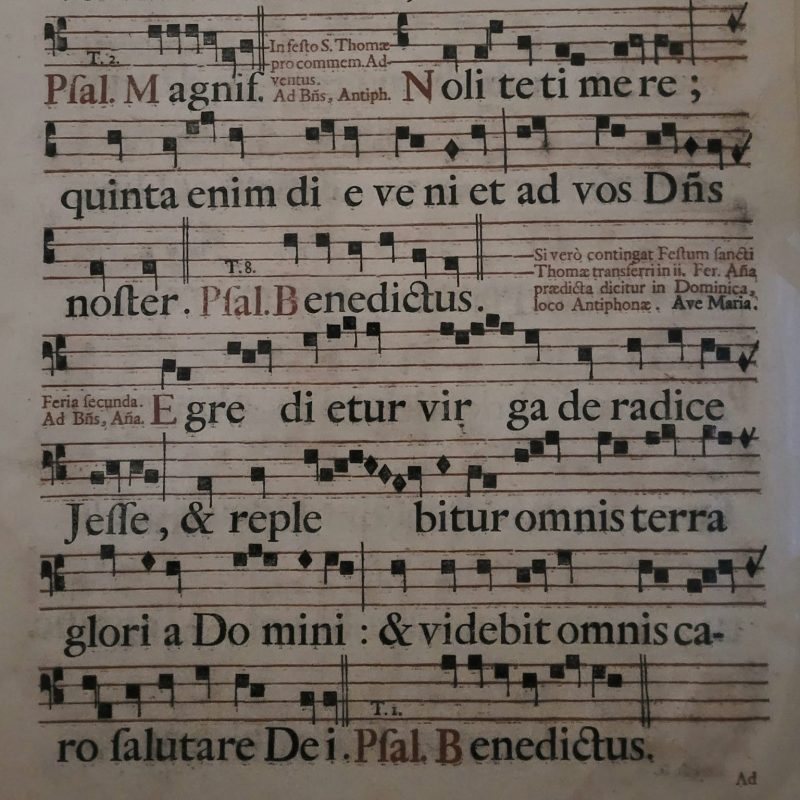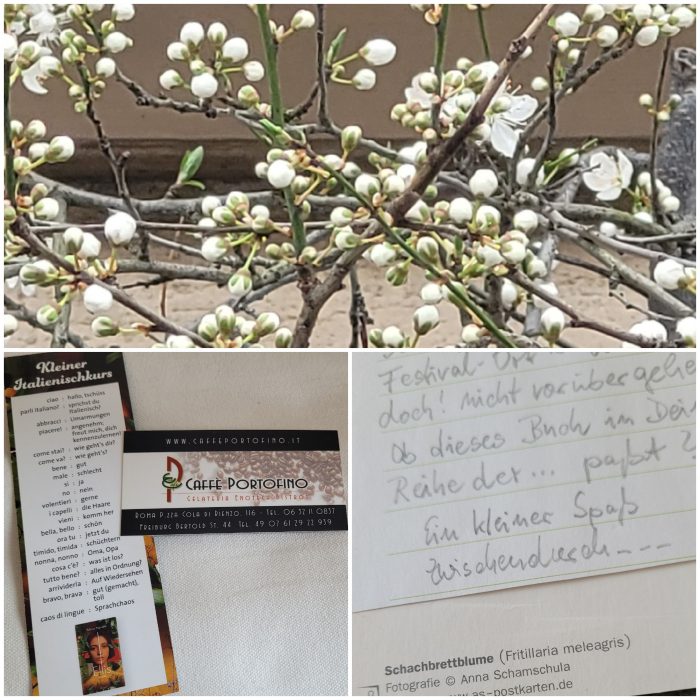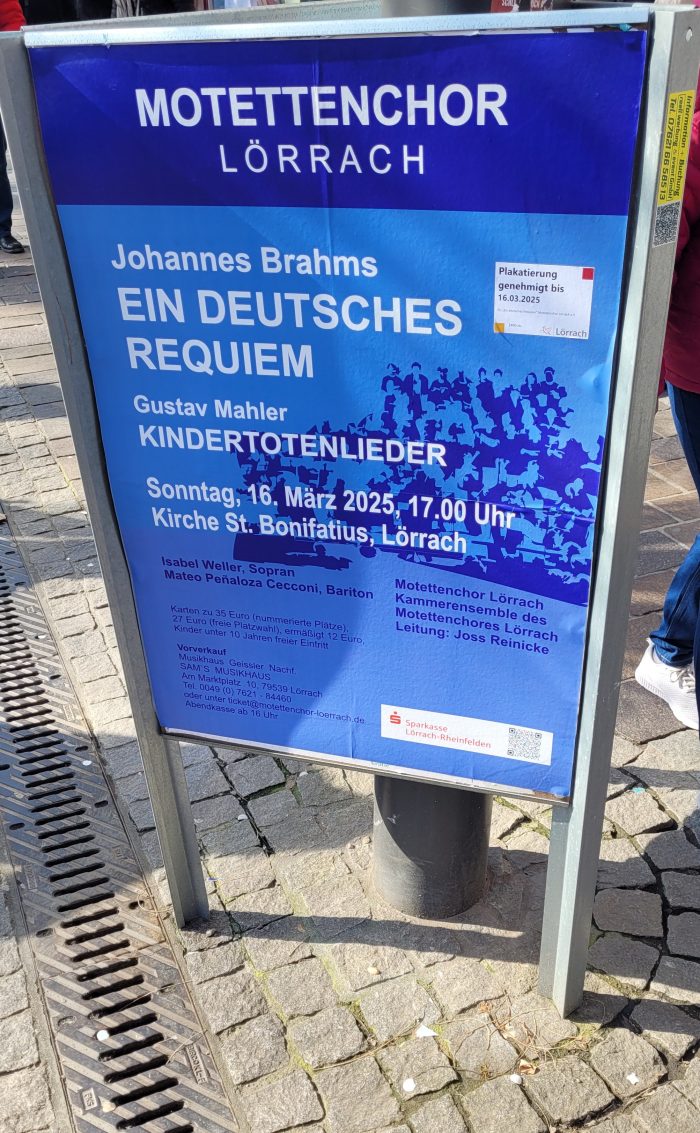ist der Titel eines Buches, das die in den Jahren 2008 bis 2012 in der „Schweizer Illustrierten“ erschienenen Kolumnen des am 15.März kurz vor seinem 90.Geburtstag verstorbenen Schriftstellers Peter Bichsel versammelt. Nachdem mein Besuch im Zug Richtung Norden saß, habe ich gestern begonnen, in diese so (hm, wie soll man sagen) schlichten wie ungeheuer dichten Erzählungen zu „versinken“. Und abends sah ich auf 3sat einen Dokumentarfilm über und mit Peter Bichsel, in dem ich wiederfand, was ich in den Kolumnen-Texten zu lesen meinte.
Zudem waren wir genau zu Frühlingsbeginn gerade erst „im Hafen von Bern“ angekommen, als nämlich die Wellen des von Renzo Piano (geb.1937) erbauten Zentrum Paul Klee uns umgaben, die sich wie eine Sinuskurve in die sanfthügelige Ackerlandschaft legen, welche unmittelbar neben der Richtung Thun und Interlaken führenden Autobahn beginnt. Geht man vom Parkplatz den entlang der Gebäudewellen angelegten Weg zum Eingang, kann man das Glück haben, gleichzeitig auf majestätisch sich erhebende Schneegipfel zu schauen und auf eine gelbe Vielzahl geöffneter Schlüsselblümchen, vor allem, wenn man an einem 20. März unterwegs ist.
Zum 20. Jubiläum der Eröffnung widmet das Zentrum dem Architekten, Zeichner, Maler, Städte- und Landschaftsplaner, dem Visionär Le Corbusier (1887-1965) eine das gesamte Lebenswerk umfassende Ausstellung, so dass man in der großzügigen Weite der Räume in Ruhe die einzelnen Stationen und Hintergründe von Le Corbusiers Schaffen und Denken mit anschaulichen, charakterisierenden Exponaten, Filmen, Fotos, Begleittexten auf sich wirken lassen kann.
Immer wieder begegnet man dabei auch ihm selbst und ist erstaunt, dass er in Anzug mit Weste, Fliege und Einstecktuch den Zeichenstift in der Hand hält, man folgt seiner Auseinandersetzung mit dem Prinzip der „Ordnung“ und wie er dann über „Die Befreiung von den Regeln“ im Spätwerk zum „Jenseits der Ordnung“ kommt.
Wir blieben lang, ohne das Verrinnen der Stunden zu merken, sahen so unterschiedliche Exponate wie geometrische Tannenmotive, Skizzen römischer und griechischer antiker Gebäude, das Aquarell eines Details aus San Vitale (Ravenna), die „main ouverte“, gesammelte Postkarten, Entwurfskizzen für Notre-Dame- du- Haut in Ronchamps, das Mass-System „Modulor“, Filmbilder aus der nach den Plänen von Le Corbusier errichteten indischen Stadt Chandigarh, die 1941 bei Editions F.Sorlot erschienene Veröffentlichung „Destin de Paris“, Fotografien aus dem von Le Corbusier entworfenen Kloster Sainte-Marie de la Tourette (nahe Lyon), zum Beispiel die Baustellenbesichtigung und der Blick in eine Mönchszelle und aus ihr heraus.
Irgendwann aber mussten wir diesen Berner Hafen, den Blick auf verschneite Alpengipfel und blütenübersäte Wiesen verlassen. Und freuen uns ein paar Tage später sehr, dass Peter Bichsel ihn uns wiederbringt, den Hafen von Bern im Frühling!
„Und das ist fast alles und wirklich nicht erzählenswert, aber es gibt unwichtige Geschichten, die kann man gut erzählen, und es gibt wichtige Geschichten, von denen man nicht mal weiß, warum sie wichtig sind.“ (aus Peter Bichsel „Der Mann mit dem gelben Motorrad“ in „Im Hafen von Bern im Frühling“, Radius-Verlag, Stuttgart 2017)

(Die Ausstellung „Le Corbusier. Die Ordnung der Dinge“ ist im Zentrum Paul Klee, Bern, noch bis zum 22.Juni 2025 zu erleben.)