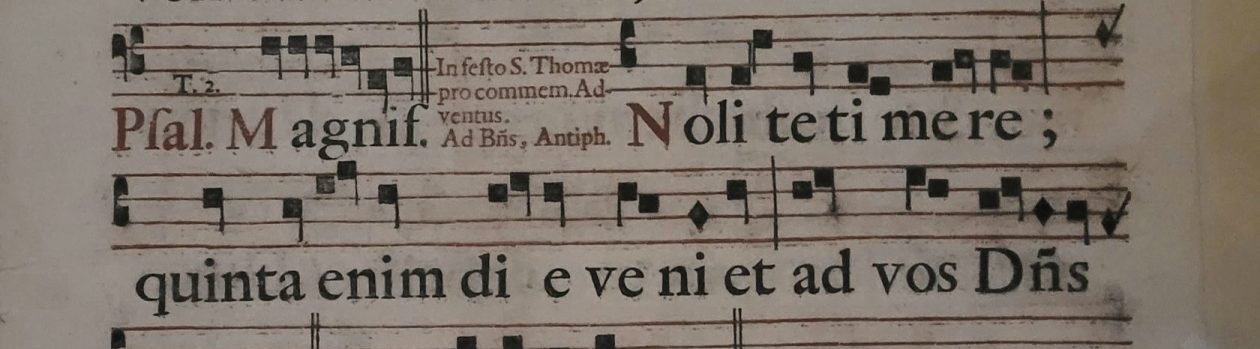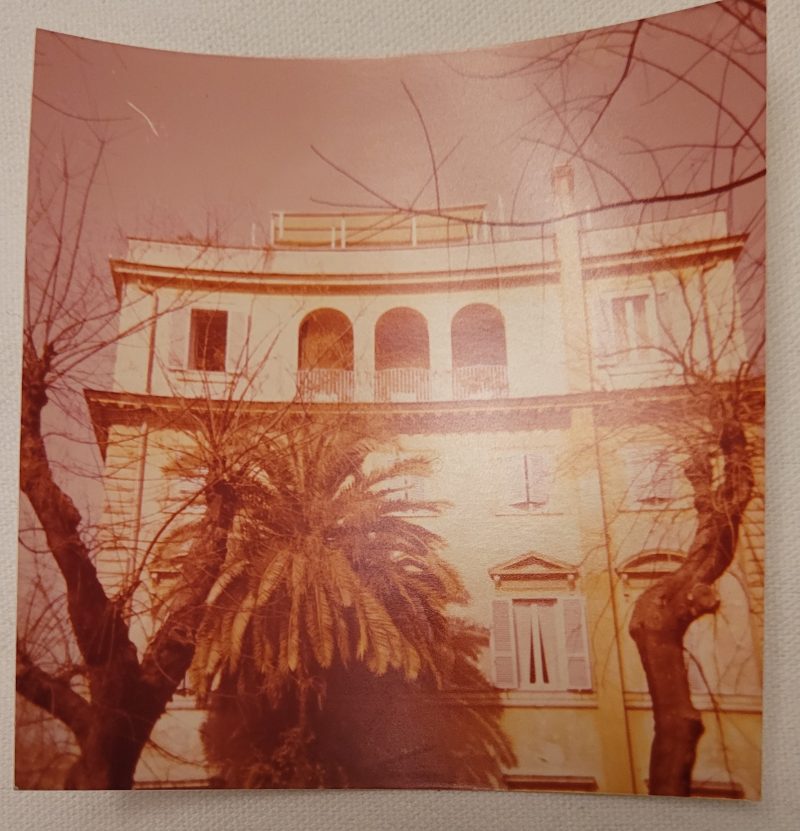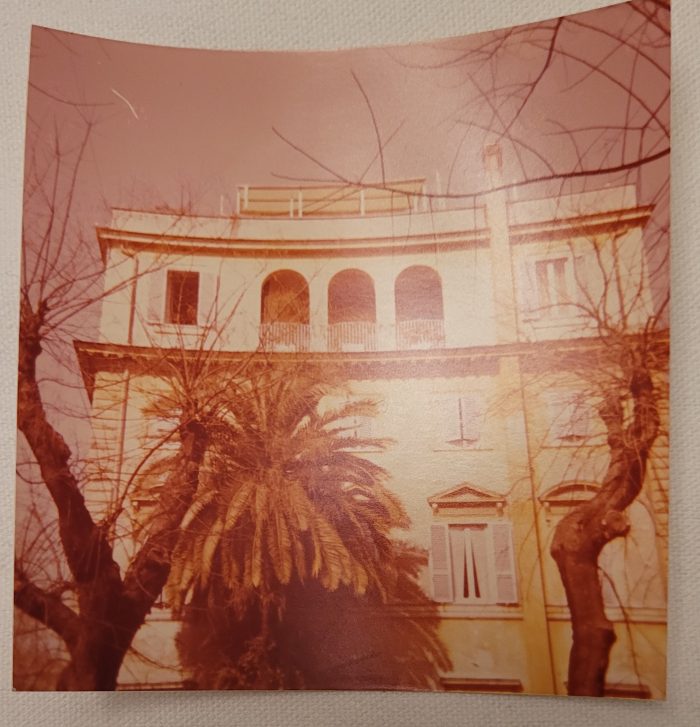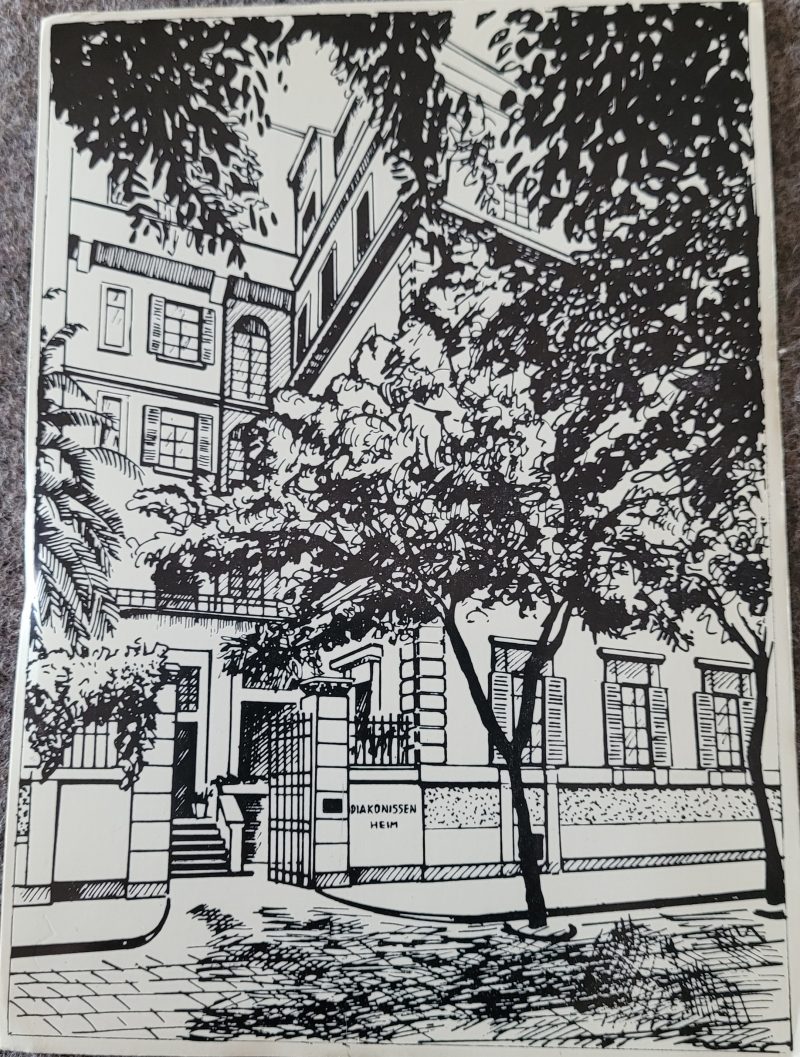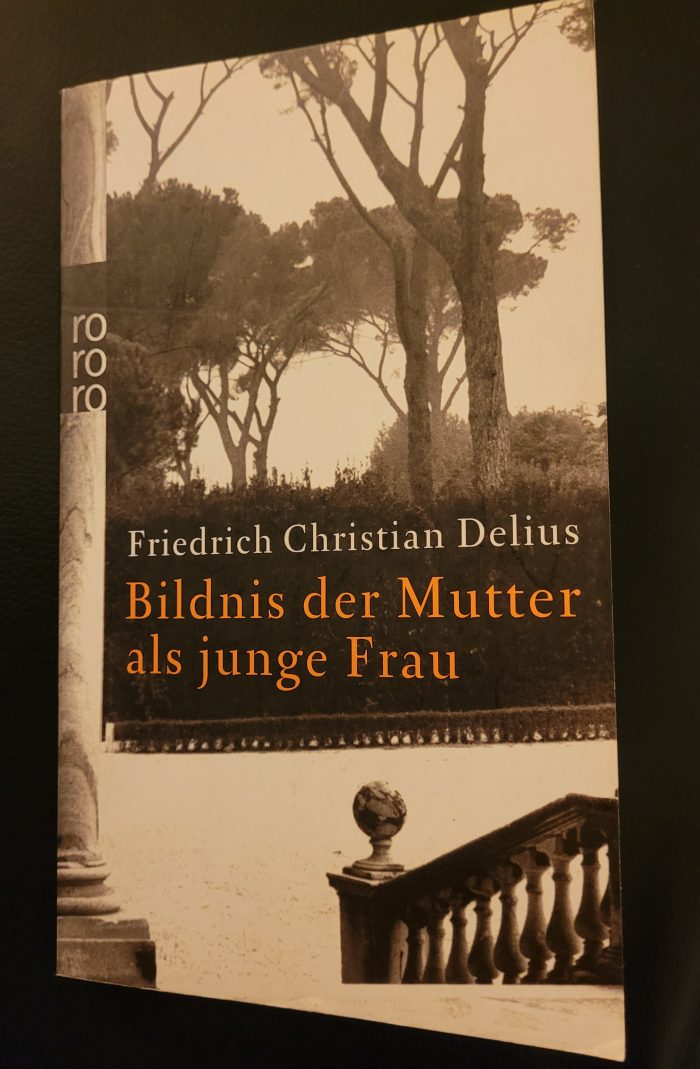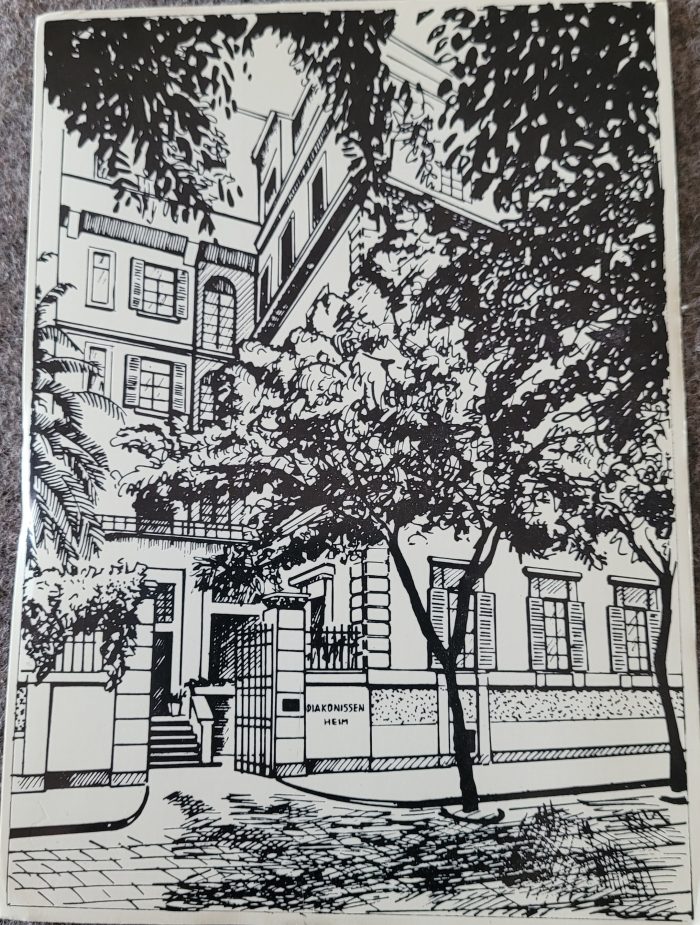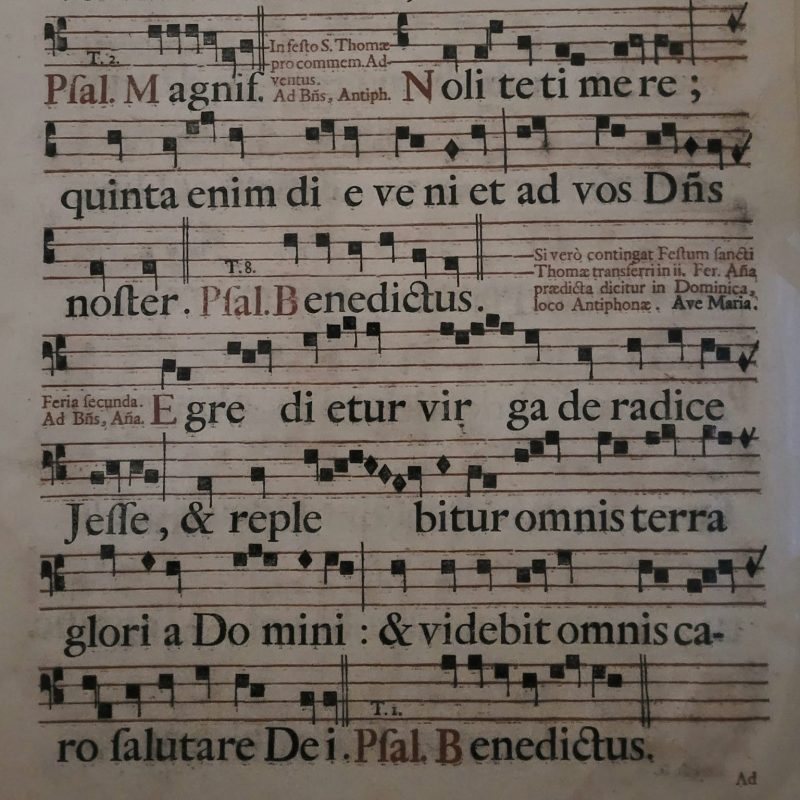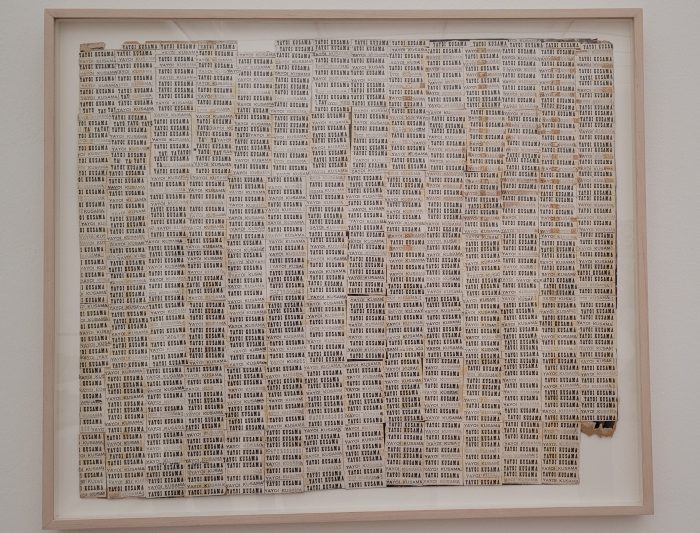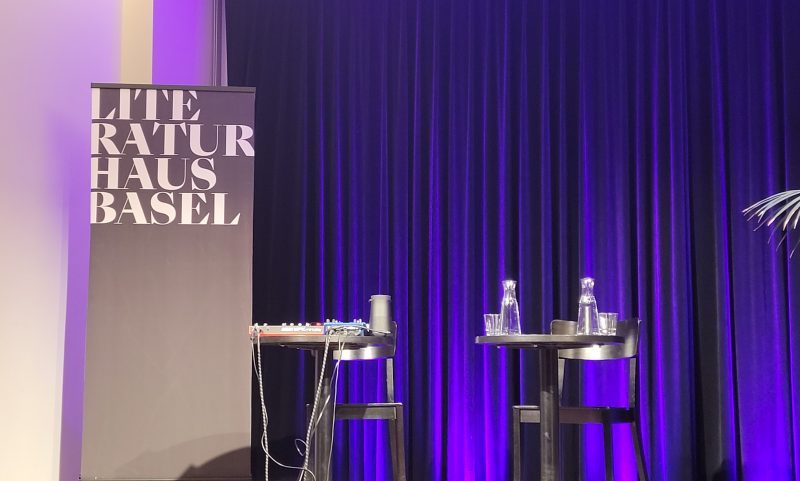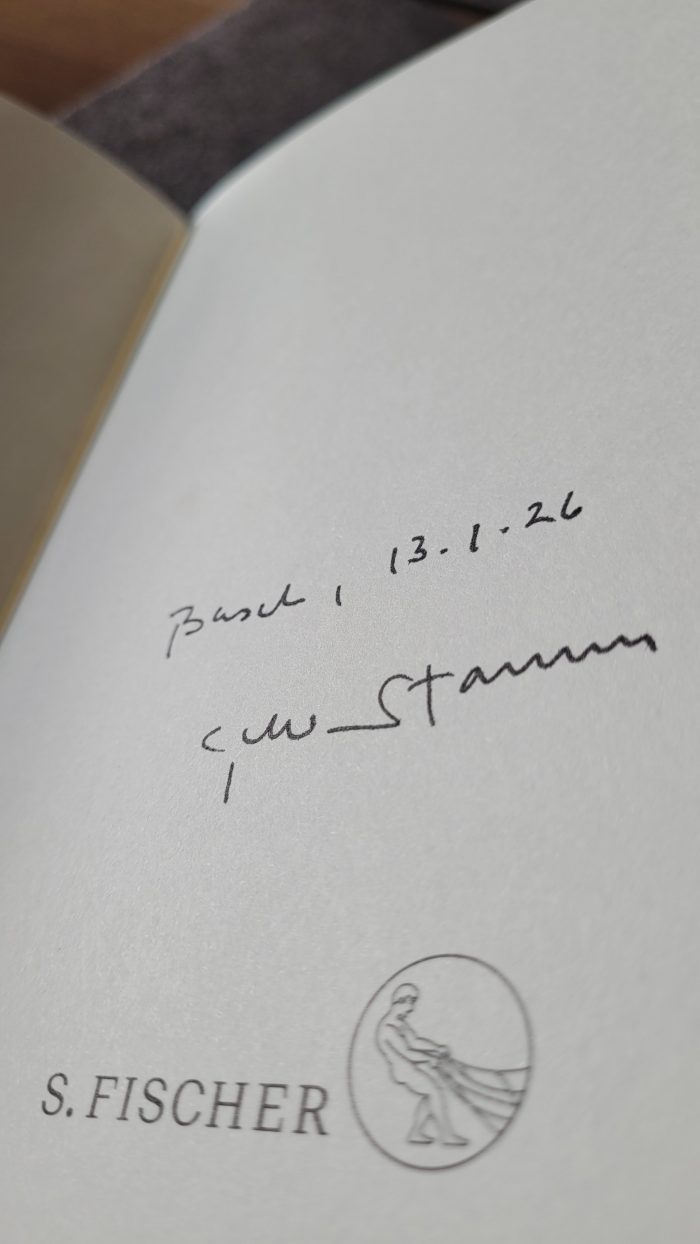Sagen Sie mal, liebe Frau A., was machen sie denn, wenn vegetarisch Speisende spontan Aufenthalte verlängern? – Ach, wissen Sie, ich liebe Aufenthaltsverlängerungen, sie geben mir Gelegenheit, meine Übungen zu vertiefen. – Was für Übungen denn? – Na die, gleichzeitig fest und biegsam zu bleiben, wie ein Bambusrohr vielleicht. – Wie ein Bambusrohr? Sie machen mir Spaß. – Das ist gut, lachen Sie ruhig, ich liebe Lachen! Und die Eigenschaften von Bambus sind doch genial, hohe Druck- und Zugfestigkeit, hohe Stabilität bei gleichzeitig hoher Flexibilität, Biegsamkeit und Bruchfestigkeit, man kann damit leicht und langlebig bauen, ich mag das. Außerdem finde ich diese Süßgräser schön. Da fällt mir allerdings ein, hohl will ich nicht sein. – Aha, da bin ich dann doch froh, hohl ist nämlich doof, bei der menschlichen Spezies jedenfalls. Aber jetzt mal weg von diesem Exkurs und hin zum Praktischen! Wie handhaben sie das? – Ganz einfach, ich befrage meinen Kühlschrank, was er so hergibt. Und kreiere ein Curry. – Ein Curry? – Jaja, so ein Gericht, das sich aus der indischen und asiatischen Küche ableitet. Der Kühlschrank antwortete nämlich mit Wirsing, Paprika, Mango, Ingwer, Knoblauch, Zitrone. Und das Vorratskämmerchen kann auch mitreden und trägt Kokosnussmilch und Mango-Chutney bei. – Soso, und damit machen Sie was? – Ghee habe ich nicht, ich nehme eine Mischung aus gesalzener Butter und Olivenöl, erhitze sie sanft, dahinein rühre ich die winzigen Würfelchen frischen Knoblauchs und Ingwers, dazu Salz und die pulverisierten Gewürze (weißen Pfeffer, Koriander, Curcuma, eine zitronig-fruchtige Java-Curry-Mischung, etwas Kreuzkümmel und Kardamom), wenn das Gewürzpotpourri im Fett sich etwas sämig verbunden hat, darf sich der frisch gepresste Zitronensaft zu ihm gesellen, der hatte sich darauf schon so gefreut. – Freude befürworte ich. – Da bin ich ganz bei Ihnen, lieber Herr Spürnase. Und schauen Sie mal, bevor ich jetzt die geschnippelte Gemüse-Obst-Mischung in den Kochtopf gebe, muss ich Ihnen was zeigen. – Was denn? Ich bin gespannt.

– Ja hier, diese Küchenabfälle. Sind sie nicht hübsch? Könnten grad beim Catwalk mitmachen. – Bei was, bitte? – Na, bei einer Modenschau, zum Beispiel an einem langen Tisch auf weißer Tischdecke. – Also, ich muss schon sagen, wie kommen Sie jetzt darauf? Die haben doch keine langen Beine. Und High Heels tragen sie auch nicht. – Jaaaaa, d’accordo, da haben Sie recht. Aber es sind Schönheiten, das müssen Sie doch zugeben. – Gut, gut, ich versuche, es mit Ihren Augen zu sehen. – Ach, vielen Dank, zu freundlich von Ihnen. Ich weiß das zu schätzen. – Sie wissen das zu schätzen? Das macht mich jetzt auch froh, das Schätzen ist nämlich in heutiger Zeit ein wenig abhandengekommen. – Ja, nicht wahr, viele haben es verlernt. Das geschnipselte Gemüse und die Mangowürfel haben aber inzwischen gelernt, im Currysud weicher zu werden, dabei aber dennoch Biss bewahrt, jetzt schütten wir die Bio-Kokosmilch dran, die zu 86% aus Kokosnussfleisch besteht und sonst nur aus Wasser, wenn wir mögen, können wir etwas Orangensaft dazu geben, auf jeden Fall aber das fruchtig-scharfe Mango-Chutney aus dem 250 -Gramm-Glas „Asian-Spirit“ mit 46% Mango-Anteil. Jetzt ist unsere Arbeit getan und wir überlassen das Ganze sich selbst und einer kleinen Weile des Vor-Sich-Hin-Köchelns, bis sich die Aromen durchdrungen und gut miteinander verbunden haben. – Hmm, ich verstehe, duftet ja schon ganz gut. Aber irgendwas fehlt mir. – Ihnen fehlt was? Das klingt nicht gut. Was fehlt Ihnen denn? – Gibt‘s denn nichts dazu? – Huch, natürlich, wie konnte ich das vergessen! Reis gibt’s dazu, die passende Reissorte war ja im Keller. Duftreis, Jasmin- oder Basmati, je nach Geschmack. – Sie haben Reis im Keller? Ich dachte, Sie bewahren ganz andere Sachen im Keller auf. – Worauf spielen Sie denn jetzt an? Ich habe keine Ahnung, was Sie meinen! – Wirklich? Naja, konzentrieren wir uns mal aufs Speisen. Da fällt mir ein, was ist denn mit dem Streuen? – Also, Sie sind aber auch wirklich unersättlich, lieber Herr Spürnase, das Streuen heben wir uns heute ausnahmsweise für ein anderes Mal auf!