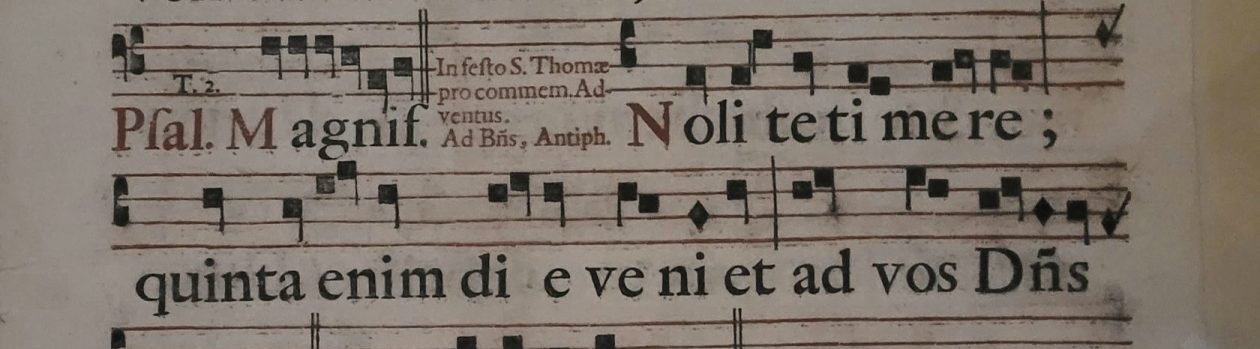Neben dem Unterwegssein mit Goethe und seinen Reisegefährten gab es auch ad hoc Schreibaufgaben mit bestimmten Vorgaben, hier eine vom 4.Oktober zu Gaben aus A.‘s Garten:
Unverhofft kommt ihr heute zu mir, ihr zwei Schönen, mit eurem Herbstgelb, das auch ins Rot changiert. Habt ihr das auch im Namen, dass ihr schön seid? Immerhin heißt ihr Mirabellen! Ich denke an admirare – bewundern und an Bella – die Schöne. Wenn meine Finger über eure Haut fahren, werden sie von rauer Glätte gebremst, und in der Hand liegt ihr wie Murmeln. Würdet ihr die hölzerne Murmelbahn herunterrollen und verhaltener als Glasmurmeln das Plopp und kein Klack von euch geben? Euer Duft erinnert mich an eure großen Schwestern, die Pflaumen, und ein wenig auch an Pfirsiche, die euch mit der Rauheit der Haut übertreffen. Am liebsten würde ich euch rasch in den Mund stecken, dann ganz langsam aufbeißen, damit sich die Frische und liebliche Säure eures Inneren auf der Zunge entfalten kann, aber es geht nicht – ich bin allergisch. So begnüge ich mich mit dem Anblick eurer Herbstschönheit und den Duftmolekülen, die ihr in meine Nase schickt. Da fällt mir ein, wenn sich noch ein paar weitere zu euch Beiden gesellen, gäbe es eine Möglichkeit, eure saure Süße zu schmecken: ich koche Kompott!
(Angelika Overath und Manfred Koch führen die Schreibschule Sent. Vor Kurzem erschien eine von den Beiden herausgegebene und mit einem Nachwort versehene sehr schöne Anthologie als Insel-Buch Nr.1549: „Rilkes Tiere“ mit entsprechenden Rilke-Gedichten/kleinen Prosatexten; siehe auch Blog-Eintrag vom 26.September 2025. Im Luchterhand-Literaturverlag München erschien 2012 das von Angelika Overath, Manfred Koch und Silvia Overath herausgegebene Buch „Tafelrunde“, das den Untertitel trägt „Schriftsteller kochen für ihre Freunde. Rezepte und Geschichten“ und das Lieblingsrezepte samt Geschichten von 37 namhaften SchriftstellerInnen versammelt; siehe auch Blogeintrag vom 2.Juli 2025)