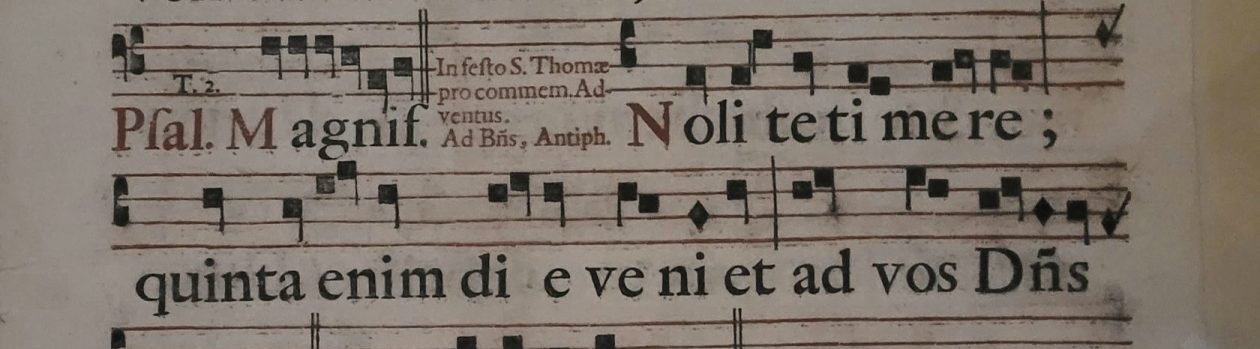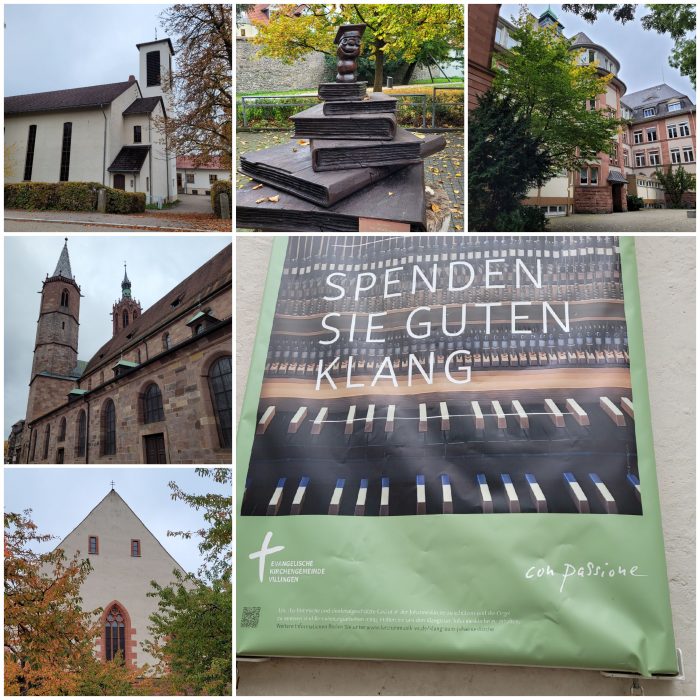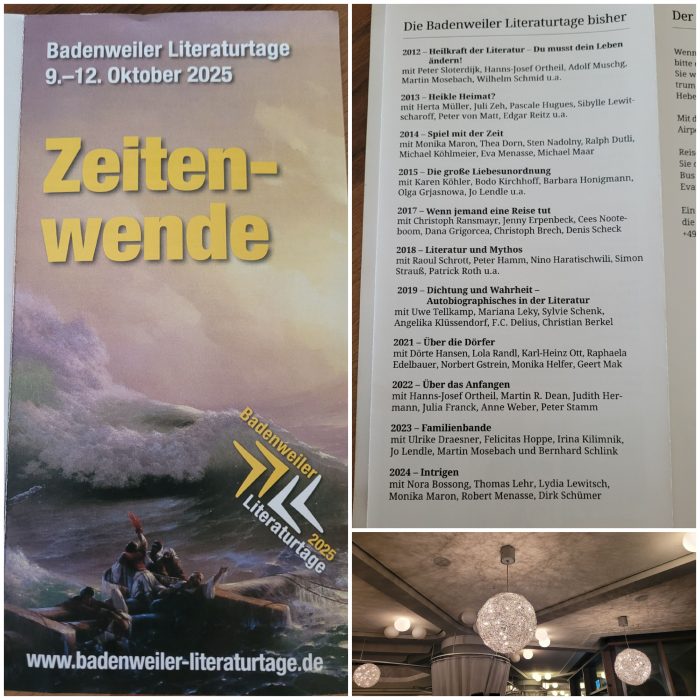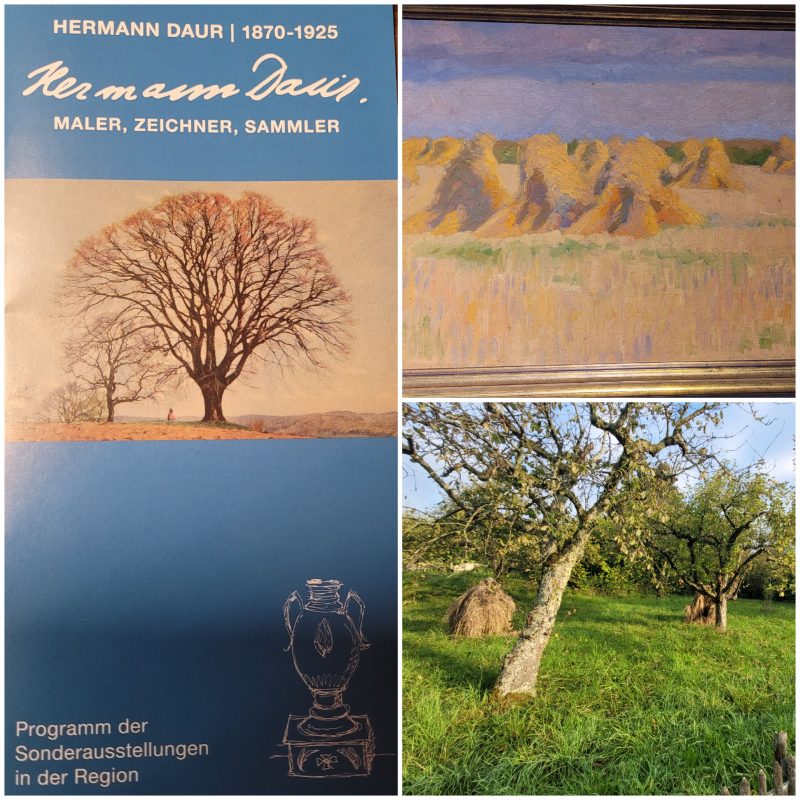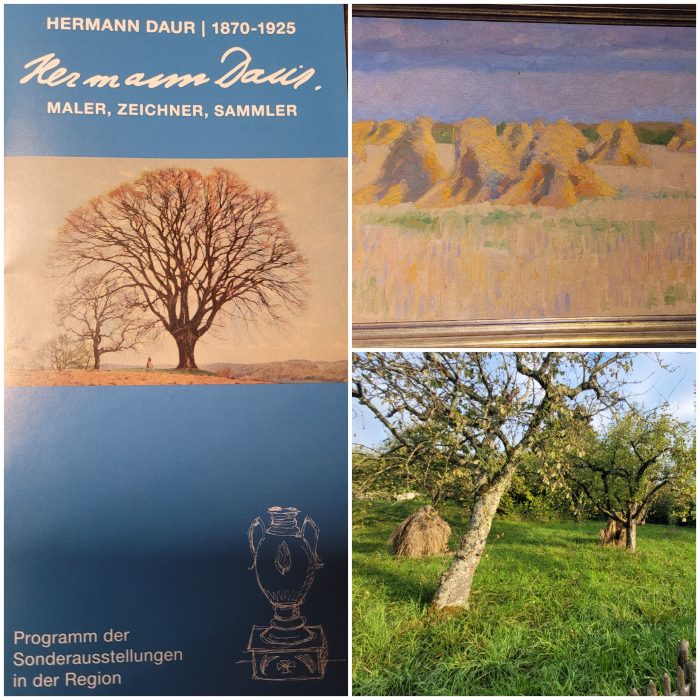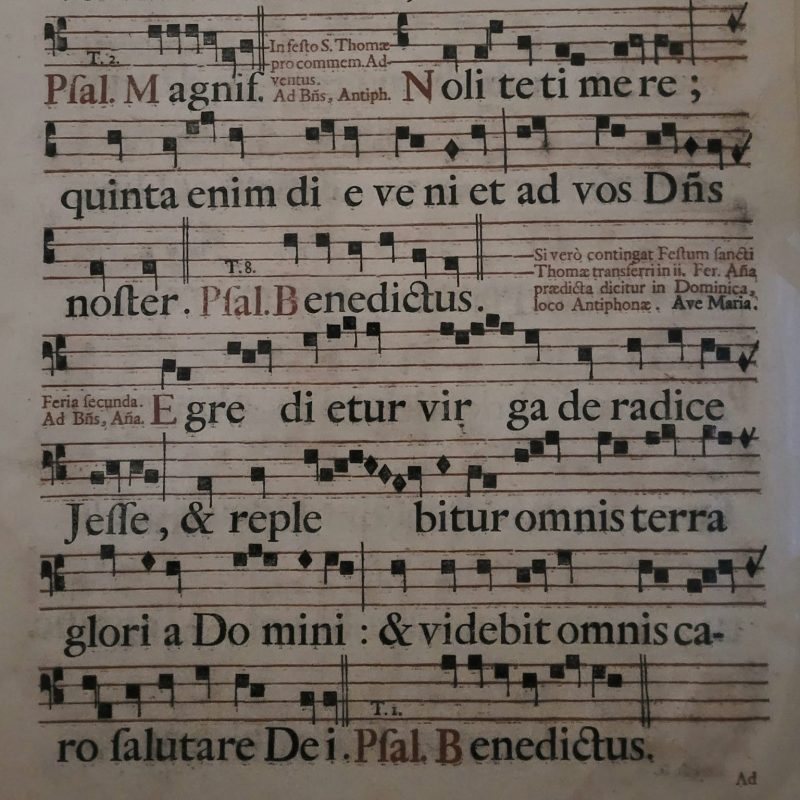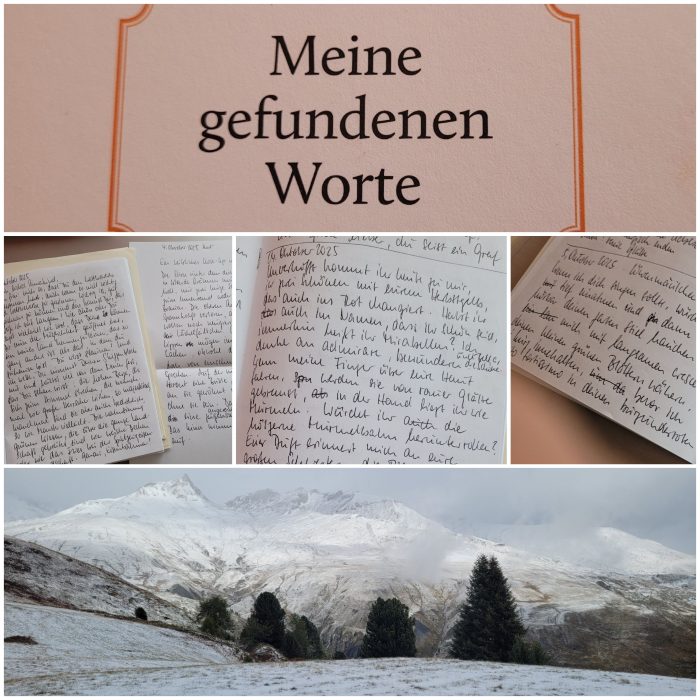Die Einladung eines Abgeordneten bringt einen durch ein Wechselspiel dichter oder duftiger Nebel mit farbengesättigter Herbstlandschaft direkt zur Konrad-Adenauer-Straße 3 in Stuttgart, wo das Baden-Württembergische Landtagsgebäude liegt, im Schlossgarten, umringt von Schauspiel, Staatsoper, Staatsgalerie, Landesbibliothek, Altem Schloss, Markthalle, Stiftskirche und Neuem Schloss (und unweit des S21-Projektes mit den Lichtaugen und den Baucontainern, auf denen in großen Lettern „Seele“ prangt). Man habe die Demokratie mitten ins herrschaftliche Herz pflanzen wollen, wird der Besuchergruppe zur Platzierung erklärt. 1959 bis 1961 erbaut, war es jedenfalls der erste Parlamentsneubau Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg, wobei der Heidelberger Architekt Horst Linde und der Stuttgarter Bauleiter Erwin Heinle auf einen Entwurf des von Mies van der Rohe inspirierten Mainzer Architekten Kurt Viertel zurückgriffen. Das Gebäude gilt als markantes Beispiel deutscher Nachkriegsarchitektur und als eines der wichtigsten Baudenkmäler Deutschlands. Klares Konzept, teilweise offene Raumstruktur und moderne Formensprache sollten für Offenheit und Transparenz der neuerstandenen Demokratie stehen. Eine Sanierung und Modernisierung 2016 brachte die Transformation des Daches in eine fünfte lichtspendende Fassade durch Einarbeitung kreisrunder Öffnungen verschiedener Größen, seit 2017 existiert das angefügte Bürger- und Medienzentrum.
Nachmittags verfolgt man vom Besucherbalkon aus einen Ausschnitt der 132.Sitzung. Die Sitzungen werden aufgezeichnet und lassen sich ein bis zwei Tage später über die Mediathek des Landtages nachschauen und nachhören. Überraschend und beeindruckend aber im Live-Erlebnis ist die Arbeit der Stenografinnen und Stenografen, die zu beiden Seiten des RednerInnen-Pultes platziert sind und alles von Hand mitprotokollieren, die Reden und alle Zwischenrufe etc. mit namentlicher Zuordnung. Wie bei einem Staffellauf übernehmen – auch im Wechsel zwischen rechts und links – nach jeweils fünf Minuten andere, greifen die Blätter und verschwinden in Nebenräume, um das in Kürzeln Mitgeschriebene in von allen lesbare Protokolle zu verwandeln. Fast schwindlig nimmt man in der Stunde des Plenarsitzungsbesuches die Menge an Stenografen und Stenografinnen wahr, die mit ruhigen und doch zügigen, routinierten Bewegungen und unbewegten Mienen ihre Arbeit tun. Wo kommen sie alle her? Sie sind begehrt, erfährt man später bei Nachfragen, keine KI kann sie ersetzen, es gibt Festangestellte und solche, die herumreisen für ihre Dienste. 200 bis 400 Kürzel vermögen sie in der Minute zu schreiben und gewinnen Medaillen bei Kurzschriftwettbewerben. So also gelingt das Mitschreiben von Demokratie.

Eine warme Spätsommersonne begleitete die Veranstaltung zum Tag der Demokratie in Lörrach, die in diesem Jahr um einen Tag auf den 20.September vorverlegt wurde. Der 1956 geborene Jurist und Publizist Michel Friedman sprach unter dem Balkon des Alten Rathauses Lörrach, von dem aus der 1805 geborene Rechtsanwalt und Publizist Gustav Struve am 21.September 1848 die Deutsche Republik ausrief, und umkreiste lobend und mahnend die über ihm auf der Flagge festgehaltenen Früchte und Aufgaben der Demokratie: Freiheit, Bildung, Wohlstand. Hörten ihm mehr Menschen zu als den Veranstaltern einer Gegendemonstration auf dem benachbarten Alten Marktplatz?
Parlamentsstenografen schreiben blitzschnell alle Reden im Landtag mit | Staatsanzeiger BW https://share.google/tzeuuCAZ2pzWcDAGl
Landtags-Stenografen holen Medaillen bei Kurzschrift-Meisterschaft | Landtag Baden-Württemberg https://share.google/iBnumRkQuj9GHQDyU