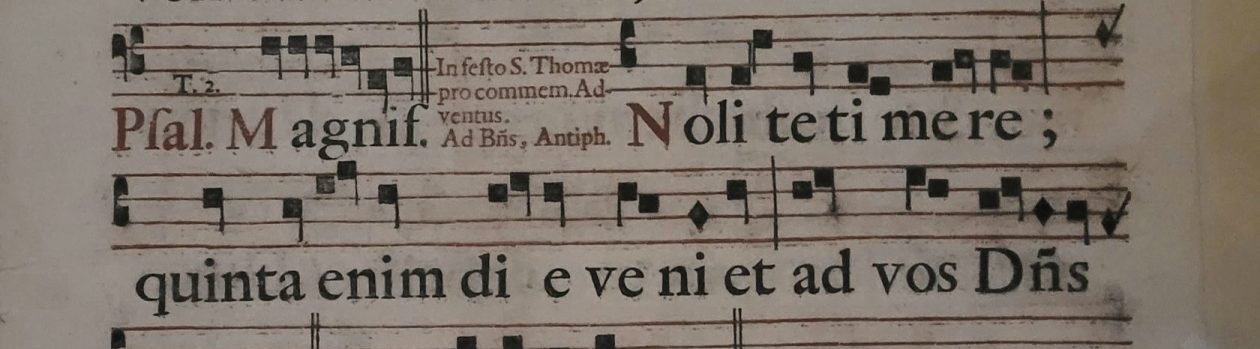Die Guggen sind unterwegs und stellen nicht nur die Larven, sondern die halbe Stadt auf den Kopf mit ihrer unverwechselbaren, stark rhythmischen, schrägen, blechernen Musik. Man hat Bühnen aufgebaut auf verschiedenen Plätzen und die Guggen reisen aus der ganzen Region an, nicht nur aus der hiesigen Deutsch-Schweizer Ecke, sondern auch aus weiteren Gegenden der alemannischen Fasnet, ich habe Cliquen aussteigen sehen aus mehreren Bussen mit VS-Kennzeichen, vom mir „vertrauten“ Busunternehmen Petrolli, das gibt es also noch. Das Ereignis am heutigen Fastnachtssamstag nennt sich Gugge-Explosion, es ist das größte Gugge-Open-Air-Event Deutschlands, ab 11 Uhr wird konzertiert, um 18 Uhr gibt es den großen Gugge-Corso, anschließend die ganze Nacht hindurch Party mit SWR 3-DJ im Hebel-Park (was würde der 1760 geborene und 1826 gestorbene Schriftsteller, evangelische Geistliche und Lehrer Johann Peter Hebel, Dichter der sogar von Jean Paul und Goethe rezensierten „Allemannischen Gedichte“, dazu sagen? Feiert seine Statue im Park heute mehr wohl oder mehr übel mit?)
Die Wortherkunft „Guggenmusik“ ist nicht ganz geklärt, offenbar hat aber Basel das Wort geboren. Wikipedia sagt mir, dass es in G.A.Seilers baseldeutschem Wörterbuch von 1879 noch fehlte, ebenso im 1901 abgeschlossenen vierten Band des Schweizerischen Idiotikons (Wörterbuch der Schweizerdeutschen Sprache). Früher waren die Bezeichnungen Tschättermusik, Charivari und Katzenmusik üblich. Ein unbegabter Blechbläser wurde wohl Ende des 19.Jahrhunderts als Gugger bezeichnet, im Schweizerischen Idiotikon wird er allerdings Güügger genannt. Eine weitere Theorie führt das Wort zurück auf den baseldytschen Ausdruck für Tüte: Gugge – die mit ihrer früheren konischen Form an Blasinstrumente denken lässt. Jedenfalls taucht eine Guggenmusik im Jahr 1906 erstmals auf im Verzeichnis der Fasnachtsumzüge neben zehn anderen Musiken. In Lörrach wurde die erste deutsche Guggemusik 1953 gegründet (Gugge 53), wobei Umzüge mit „Lärmgeräten“ , häufig mit Maskierungen, im hiesigen Kulturkreis bei Winter- und Frühjahrsgebräuchen seit Jahrhunderten üblich sind.
In den Schaufenstern der Bäckereien und Konditoreien hat das traditionelle Fettgebackene seinen Auftritt, daneben werben „Güggel, Frösch un Schnägge“ für den neuen Lörracher Narrenmarsch, den der Schopfheimer Markus Götz unter Verwendung musikalischer Schlüsselmotive der Lörracher Fasnacht komponierte und der am 6.Januar 2024 beim Neujahrsempfang der Narrengilde Lörrach uraufgeführt wurde.
Der Güggel wiederum ist keinesfalls verwandt mit Gugge, sondern als auf dem Misthaufen krähender Hahn repräsentiert er den ländlich geprägten Ortsteil Tumringen.
Die Frösch entspringen dem früher von Auen und Sumpfgebieten umgebenen Ortsteil Stetten.
Bleibt der Schnägg. Woher kommt er wohl? Na klar, von den Weinbergschnecken, die sich in den Reben rund um Tüllingen tummeln und als lokale Delikatesse insbesondere zur Zeit der Fasnacht serviert werden, weswegen der Lörracher Narrenruf auch tönt: „Friß´n wäg, dr Schnägg!“