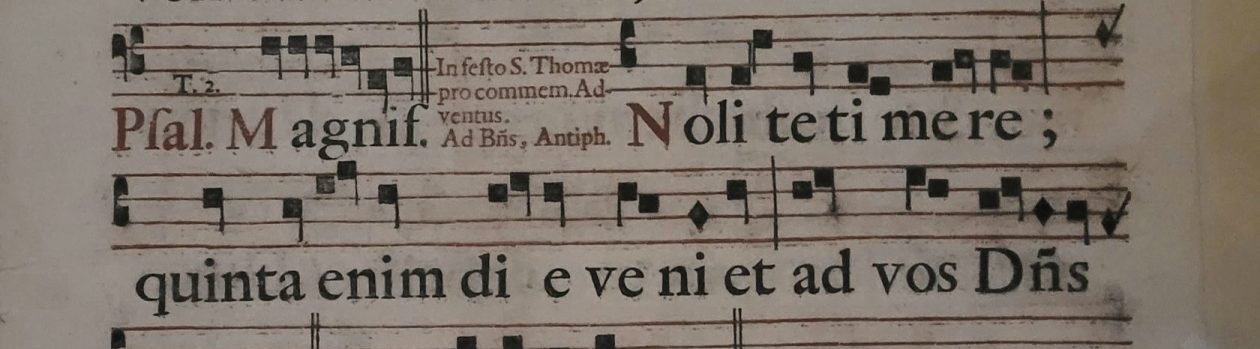„Man schrieb Anno Domini 1271. Obgleich der Himmel in lieblicher Bläue herniederlächelte, die ganze Natur Frieden atmete, war doch im Bistum Basel und den angrenzenden Landschaften von nichts weniger denn vom Frieden die Rede“ – so beginnt der 1910 veröffentlichte historische Roman von Käthe Papke (1872-1951) „Die Letzten von Rötteln“, der – von alten Chroniken ausgehend – in einer fiktiven Geschichte Geschehnisse auf und um die Burg Rötteln zur Zeit des Rudolf von Habsburg, des späteren römisch-deutschen Königs, lebendig werden lässt.
Lieblich blau lächelt der Himmel auch am Abend des 20.Juni zum Auftakt der diesjährigen Burgfestspiele, zu denen sich Jahr für Jahr (Laien-)Schauspieler für Aufführungen in der imposanten Kulisse der drittgrößten Burgruine Badens zusammenfinden. Will man dem Gedränge auf dem oberen Parkplatz entgehen, wählt man einen von Steinen und Wurzeln durchwirkten Weg, der durch alten Buchenbestand auf die Anhöhe führt und fühlt sich in kühler grüner Kathedrale, bevor einen auf den Plateaus zwischen alten Mauerresten wieder die laue Luft des Sommerabends umfängt. Wehrhaft und wohnlich war Burg Rötteln und die Ruine zeugt noch heute davon, der Giller (ein kräftiger Viereckturm) bewacht den Zugang, der aus Quadersteinen errichtete Bergfried erhebt sich weiterhin an höchster Stelle, dass das Hauptgebäude dreigeschossig und mächtig war, lässt sich noch erkennen, aber ziemlich sicher stammt der im Burghof ausgeschenkte Wein nicht aus dem noch erhaltenen Weinkeller unter dem alten Südbau. BurgLiebe heißt die Burgschenke, die an den Theaterabenden im Biergarten erfrischende Getränke und kleine Speisen bereithält, das ehemalige (vor allem für Fischgerichte bekannte) Restaurant hier oben hatte vor Jahren aufgegeben (ohne dass ich es von innen gesehen hätte). Die Burgschenke passt gut zum alten Gemäuer, das mehrere Vorhöfe umschließt, wir stellen das funkelnde Glas auf ihm ab und gönnen den Augen die Weitsicht auf Lörrach, auf Basel und den Schwarzwald. Dann kündet ein Signal vom nahenden Vorstellungsbeginn, wir nehmen unseren Platz ein, zur Linken eine hohe Mauer, deren Durchlass auch dem Auf- und Abtreten der Spieler dient. Gegeben wird „Tartuffe – der Betrüger“, eine etwas adaptierte Version von Molières Komödie, die (religiöse) Scheinheiligkeit und Heuchelei in solch einem Maß kritisiert, dass sie nach der Uraufführung im Beisein des Sonnenkönigs in Schloss Versailles am 12.Mai 1664 einen Theaterskandal auslöste und zunächst verboten wurde (auch eine zweite Fassung wurde 1667 verboten, die am 5.Februar 1669 im Palais Royal deutlich geänderte dritte Fassung erhielt dann die Unterstützung Ludwig des XIV.) Unter freiem Himmel, der während der beiden Aufführungsstunden nur langsam an Helligkeit verliert, lauschen wir gerne den wort – und temporeichen Dialogen der deutlich gezeichneten und von den Darstellern gut ausgefüllten Figuren, dem eigensüchtigen, instrumentalisierenden Blender und dem, der sich blenden lässt (oder blenden lassen will), der scharfsichtigen, zungenfertigen, geschickten Dorine und allen anderen, wir lächeln und lachen, aber es meldet sich (wenn auch gemildert durch den Sommerabend), wie beim auf Burg Rötteln angesiedelten Roman von Käthe Papke, die Beklemmung angesichts nicht zu übersehender aktueller Parallelen.
Wir singen weiter, sagt die Chorkollegin, als wir über Steine und Wurzeln in der nun doch einbrechenden Dunkelheit den Weg zurück zum Parkplatz gefunden haben. Ja, antworte ich, unbedingt.

(Käthe Papke: Die Letzten von Rötteln; meine Ausgabe: Christliches Verlagshaus Stuttgart 1977)