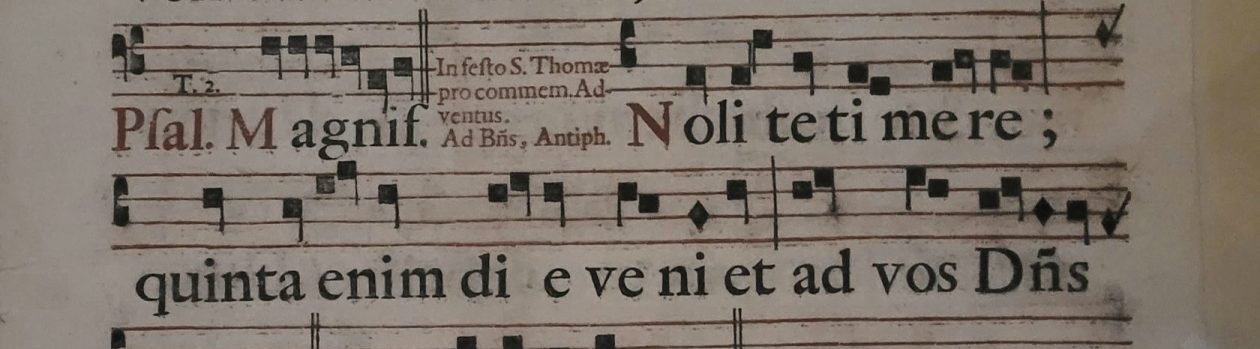Zu einer der 52 Wanderungen begleitet man Franz Hohler auf den „Mons rigidus“, also den Rigiberg. Die Römer hätten ihn so genannt, weil er „stotzig“ sei, also steil. Eigentlich meint „rigidus“ ja steif und die Namensherkunft der „Regina montium“, wie der Dekan des Klosters Einsiedeln, Albrecht von Bonstetten, die Rigi in seiner Landesbeschreibung des eidgenössischen Gebiets 1479 taufte, ist wohl am ehesten dem schweizerdeutschen Gattungswort „Rigi“ zuzuschreiben, das eine horizontal laufende Schichtung bezeichnet. Darauf deutet die im 14. und 15. Jahrhundert gebräuchliche Verwendung der Pluralform „Rigenen“ hin, die 1439 durch die Verwendung des Singulars ersetzt wurde, wobei das sprachgeschichtlich richtige weibliche Geschlecht zwar nun meist, aber insgesamt nicht durchgehend verwendet wird. Die/der Rigi ist also ein Zwitterwesen.
Franz Hohler ist an einem Märzsonntag auf dem Rigi und sieht vor sich das „Inselreich der Alpengipfel“, das von „einem atlantischen Nebelmeer umspült“ wird, was ihn über allerlei dort herumschwimmende Steinzeittiere fantasieren lässt.
Das kann ich nachvollziehen, denn auch ich fahre an einem Tag im März mit dem Kursschiff „vo Luzärn uf Wäggis zue“, wie es im Rigilied heißt, das Johann Lüthi 1832 komponierte, allerdings begegnen mir im Schiff nicht die „schönen Maidli“ der zweiten Strophe, sondern eine Gruppe junger Männer, jeder mit Gebetsriemen und Kippa angetan. Das Schiff gleitet durch dichten Nebel, nur ab und an sehe ich an den Ufern Boote in ihren hölzernen Häusern hängen. Ich steige nicht in Weggis aus, sondern erst in Vitznau, wo mich die Schifflände um 10:09 Uhr mit ihren Jugendstilbuchstaben empfängt. Wenige Schritte sind es nur bis zur Zahnradbahn, die mich auf die Königin der Berge befördern soll. Dann geht es los, der Aufstieg beginnt, „liebi Gäscht“ sagt eine freundliche Stimme und „wir freuet üüs“, ich freue mich auch, zumal ich bald dem Nebelmeer enthoben bin, eine Märzensonne den Himmel erhellt und sich auf den Bergwiesen Unmengen von Schlüsselblumen tummeln. Dann bleibt mir das Himmelsblau, als ich in Kaltbad auf 1423 Meter über Normalnull aussteige, die Sonne spielt nun aber nicht mehr mit den gelben Blüten, sondern mit dem Schneeweiß, das ihr gerne ein Funkeln zurückwirft. Ich mache mich auf den ebenen Weg Richtung Känzeli und verpasse nicht die Waldkirche, die mich hinter einem hohen Felsbrocken überrascht, das Dach ihres mit Holzschindeln versehenen Vorbaus trägt eine Schneekappe und in ihrem Innern erwartet mich neben der Stille ein warmes Leuchten. Beim Weitergehen entdecke ich 900 Meter unter mir die Hohlerschen Seeungeheuer, die aufgetaucht sind, aber keinen Schrecken verbreiten, weil sie inmitten weißer Wattebäuschchen, in die der Nebel sich verwandelt hat, friedlich lagern. Bis ich beim Känzeli angelangt bin, hat die Sonne auch die Wattebäuschchen auseinandergerupft und ich habe einen wahrhaft königlichen Blick auf Luzern, auf die Wasserläufe des Vierwaldstättersees und auf die Firnis der Alpengipfel gegenüber.
(Franz Hohler „52 Wanderungen“, Luchterhand Literaturverlag München, 4.Aufl.2005)