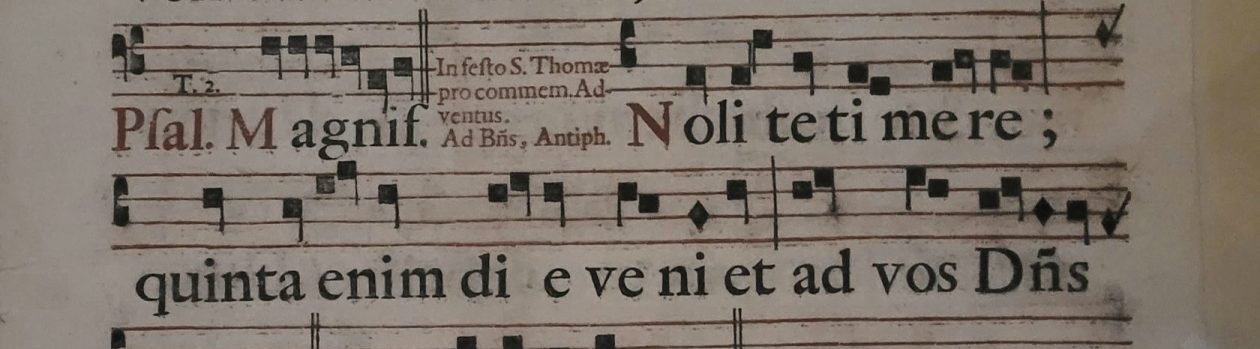Bevor meteorologischer Winter und Adventszeit beginnen, schaue ich zurück auf die achten Herbstfreuden, die Retraite am Thuner See.
Gegen 16:10 Uhr am Tag des Hl. Martin von Tours erreiche ich den Schlossweg 3, das Licht neigt sich bereits dem Abend entgegen und ummantelt Landschaft und Anwesen mit mildem Leuchten: das Goldgelb des Gingko-Baumes zur Rechten, die Nadelbäume zur Linken, das satt aufsitzende Haupthaus vor mir, dessen tief gezogenes Zeltdach ein Zwilling des Berges ist, der auf der anderen Seeseite nicht bedrohlich, sondern wie ein Beschützer regiert. Das hat er schon getan, als das vom Augustinerkloster Interlaken errichtete Rebhaus ihm gegenüber 1133 erstmals urkundlich erwähnt und das daraus erwachsene Rebgut Ralligen im Jahr 1465 als Lehen dem Thuner Schultheiß Peter Schopfer überlassen wurde. Weinbau wird 560 Jahre später nicht mehr betrieben, einzelne Rebranken zieren die Gebäude, von Früchten der Obstbäume und aus Gemüsegärten werde ich kosten, Palmen auf der Sonnenterrasse und übers Gelände verteilte Zypressen sind Zeugen von günstigem Klima, haben einen Tessiner Anklang und versetzen mich in den Süden. Noch nie war ich hier, obwohl ich die evangelische Kommunität, die das ab Ende des 19.Jahrhunderts bis zum zweiten Weltkrieg als Koch- und Haushaltungsschule geführte Schloss vor bald 50 Jahren erwarb, schon ebenso lang, ja sogar ein paar Jahre mehr kenne. Am 24.März 1972 schwärmt die 13-Jährige in ihrem neuen Tagebuch: „Heute war der letzte Abend und der allerallerschönste. Die Woche mit den Christusträgern war ja so toll, so temperamentvoll mit den schönen Songs. Und der Bruder D., den mag ich so schrecklich, er ist wirklich ein einmaliger Mensch. Und auch Saarländer und er hat auch einen Jugendkreis geleitet. Und er redet so toll und überzeugend…“ – Saarländer und Jugendkreisleiter waren dabei die Parallele zu meinem Vater. Am Martinitag 2025 werde ich Bruder D. wiedersehen, nachdem man mich zu meinem Zimmer gebracht hat, ich sehe ihn auf dem Foto in einem Jubiläumsband, der auf dem Tisch liegt. Der junge Bruder, der mich zum Zimmer bringt, führt mich am Haupthaus und an blauen Kisten mit erdbefleckten Zwiebeln vorbei, das Zimmer entpuppt sich als ganzes Holzhäuschen, wie geschaffen für die stillen Tage, eine einfache und doch komfortable Kajüte mit allem, was ich brauche. Ich trete ans hohe Fenster, es lässt sich zu einem kleinen Balkon hin öffnen, das Licht fällt schon, vertieft dabei aber sein gelbes Leuchten über dem zunehmenden Dunkel der Hügel, der See nimmt es auf und hält es noch lange, ehe eine blaue Dämmerung Bäume und Berge in einen Scherenschnitt verwandelt und der Niesen sich schließlich nicht mehr abgrenzen will vom Himmel, selbst seine dünne Schneehaube ist nicht mehr auszumachen, nur eine einsame Laterne schwebt irgendwo hoch oben über nachtschwarzem Wasser. Ein leises Plätschern lässt noch den steinernen Brunnentrog erahnen, der sich unterhalb des Balkons an die Mauerbrüstung der Terrasse lehnt, aber das Herbstlaub auf dem Sechseck der Holzbank, die den dicken Stamm einer gestutzten Winterlinde umfängt, sehe ich nicht mehr. Ich laufe zum Haupthaus, aus dessen Fenstern goldgelbes Licht fließt, auf dem Gutsgelände weiter oben erhellt ein Herrnhuter Stern den Giebel eines Chalets. Im holzgetäfelten Refektorium versammelt man sich nicht mehr zu den Mahlzeiten (das geschieht in einem einfacheren Speisesaal), auf rotsamtenen Sitzflächen der Stühle liegen Liederbücher, das tiefbraune Leder einer alten Couchgarnitur zeigt stolz Narben und Falten, die randständigen Nieten leihen sich Glanz vom Kerzenlicht. Jemand sitzt mit dem Smartphone hier, WLAN gibt es nur im Haupthaus zu bestimmten Zeiten des Tages. Später knackt und knistert ein Feuer, es wärmt einen hohen Raum mit weiß verschlemmten Wänden und wirft flackerndes Licht aufs asketische, aber rote Gewand Johannes des Täufers, der vor dichtem Baumgrün und Bergzügen am Horizont aus seiner rechten Hohlhand Wasser auf Jesu Haupt fließen lässt.

(Fortsetzung folgt)